Hitze, die ins Haus gelangt ist, muss wieder raus! Am einfachsten und effizientesten klappt das, wenn Sie nachts und frühmorgens viele Fenster öffnen, damit kühle Luft von draußen nachströmen kann. Recht effizient wirkt die Querlüftung von einem Fenster zum anderen. In Einfamilienhäusern ist oft die Vertikallüftung ideal: Warme Luft kann aus den Dachfenstern entweichen, über Keller- oder Erdgeschossfenster strömt kühle Luft nach.
Tipp: Gekippte Fenster sind für Einbrecher geradezu eine Einladung. Fenster, die Sie zum Lüften nutzen, sollten Sie daher unbedingt zusätzlich schützen. Für Kellerfenster empfehlen sich zum Beispiel massive Gitter oder Lichtschachtsicherungen – und zusätzlich Mückenschutzgaze.
Lüften mit Technikunterstützung – gut für Allergiker
Mit moderner Technik lässt sich das Lüften perfektionieren. Über Rohrleitungen transportieren Ventilatoren die kühle Frischluft ins Haus und saugen die verbrauchte warme Luft gezielt ab. Per Zeitsteuerung lässt sich so die nächtliche Kühle optimal nutzen. Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnungsfunktion verfügen in der Regel über eine spezielle Luftführung, mit der sich der im Winterhalbjahr so nützliche Wärmetauscher im Sommer umgehen lässt. Automatisch arbeitende Lüftungsanlagen bieten für Allergiker einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Fensterlüftung: Die angesaugte Luft kann durch einen Pollenfilter geleitetet werden.
Das leisten Ventilatoren
Mietern jedoch sind bei baulichen Veränderungen meist die Hände gebunden. Daher gilt ihr erster Gedanke oft einem Ventilator. Der kostet in der Regel nicht viel und ist schnell gekauft (siehe Ventilatoren im Test). Generell sorgt ein Ventilator für ein Gefühl von kühler Luft auf der Haut. Der Schweiß auf der Haut verdunstet im Luftstrom schneller und führt so die Wärme vom Körper schneller ab. Kurzum: Es wird zwar nicht kühler im Zimmer, aber es fühlt sich kühler an, da der Körper abkühlt – solange der Ventilator die Luft im Raum bewegt. Fazit: Ventilatoren sind eine einfache und oft kostengünstige Erste-Hilfe-Maßnahme zum Hitzeschutz.
Tipp: Ventilatoren können auch beim morgendlichen Lüften helfen. Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite vor das geöffnete Fenster. Dann pustet es den frischen Morgenwind zügig ins Zimmer.
Ventilatoren mit Rotorwalze oder Flügeln
In unserem Test von Ventilatoren befanden sich Tisch-, Stand und Turmventilatoren − darunter sehr einfache Modelle, aber auch Lüfter mit Extras wie Fernbedienung, Timer sowie an- und abschwellendem Luftstrom. Die meisten Tisch- und Standmodelle arbeiten klassisch mit Propeller und lassen sich im Kippwinkel verstellen, so dass sie mehr nach oben oder nach unten blasen. Turmgeräte lassen sich konstruktionsbedingt nicht neigen. Die Turmventilatoren in klassischer Säulenform saugen über eine schaufelradartige Walze Luft von hinten an und pusten sie vorn aus. Die Ventilatoren von Dyson saugen die Luft über ein Gebläserad im Sockel an und blasen sie über eine umlaufende Ringspalte aus, was Luft von hinten mitreißt. Alle geprüften Geräte können horizontal nach rechts und links schwenken.
Tipp: Im Ventilatoren-Test finden Sie gute, leise Geräte aus allen drei Produktgruppen. Der günstigste gute Turmventilator kostet nur etwas mehr als 60 Euro.
Luftkühler: Ventilator mit zusätzlichem Kühleffekt
Luftkühler – auch Kühlgeräte oder Aircooler genannt – gelten als günstige Alternativen zu Klimaanlagen. Das Prinzip: Sie saugen warme Raumluft an und leiten sie durch einen Filter, der mit kaltem Wasser aus einem Tank befeuchtet wird. Dabei wird der Luft Wärme entzogen, ein Ventilator bläst die kühlere Luft wieder in den Raum.
Aber wie gut funktioniert das tatsächlich? Unser Schweizer Partnermagazin Saldo hat zehn der Geräte getestet (kostenpflichtig). Das Ergebnis enttäuscht: Die meisten drückten die Temperatur in dem 26 Quadratmeter großen Testraum um höchstens 0,3 bis 0,6 Grad Celsius, zwei brachten noch weniger Abkühlung. Laut einer Studie können Menschen Temperaturunterschiede von etwa 0,9 Grad Celsius wahrnehmen. Weiterer Kritikpunkt: Je länger die Geräte laufen, desto feuchter wird die Luft im Raum, was die Schimmelgefahr erhöht. Sie sind daher allenfalls für kleine, trockene Räume geeignet.





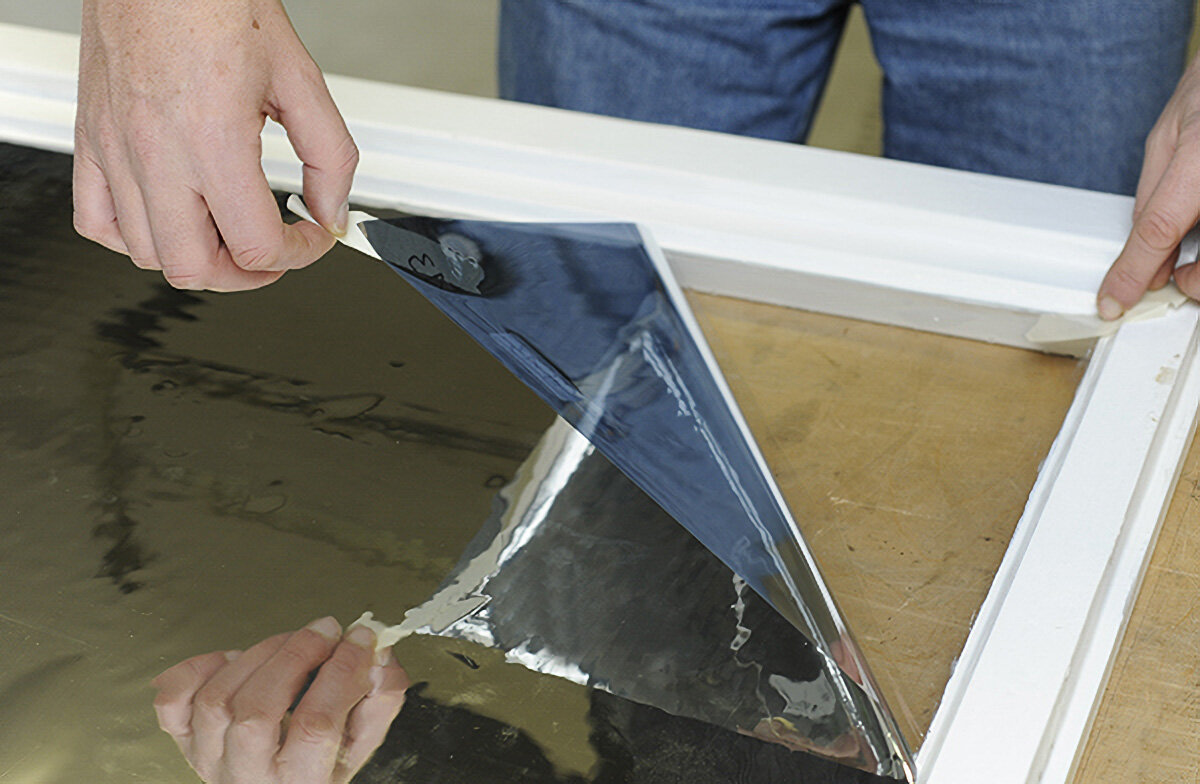

Kommentarliste
Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.
Super Artikel, aber wie schade, dass die einfachste Art der Abkühlung fehlt:
Handfächer!
Braucht keinen Strom, nicht so teuer - und gibt es auch nachhaltig(er) aus Bambus bspw. und von sozial engagierten Firmen (bspw. www.imafan.eu).
Die Kühlen ab, egal wo man ist und kann man immer mitnehmen; deshalb hätte ich mir das in der Übersicht wirklich mit gewünscht!
Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu: mitdenken schon bei der Planung ist der beste Schutz und in kühlende Naturschutzmaßnahmen investieren- Bäume pflanzen, mehr wild wachsen lassen... da gibt es noch viel zu tun, und fände ich auch gut und wichtig zu erwähnen im Zusammenhang mit Hitze! Danke.
@Cirticon: Da stimmen wir Ihnen zu, ein effektiver Hitzeschutz sollte bereits bei der Bauplanung und -ausführung bedacht werden. Dazu haben wir in unserem Beitrag verwiesen: Bauherren und Architekten sollten schon bei der Planung eines Gebäudes an den Hitzeschutz denken. Große Fensterflächen auf der Südseite, fehlende Beschattung, schlechte Gebäudedämmung, falsch konzipierte Wintergärten – so manche Entscheidung kann im Sommer schweißtreibende Konsequenzen haben. Oft betrifft die Fehlplanung Dachgeschosswohnungen. Hier dominieren Leichtbaustoffe, die sich bei Hitze schnell erwärmen. Besser sind massive Baustoffe wie Ziegel oder Kalkstein. Sie können viel mehr Wärme speichern und wirken als kühlender Puffer...
Unsere Empfehlung sollen helfen, trotz einiger baulichen Mängel für ein besseres kühleres Klima im Sommer zu sorgen.
Das Wichtigste und einfachste Mittel gegen Hitze in Innenräumen haben Sie leider nicht genannt: Verstand am Bau! - Unser Haus (bei Berlin) wurde 2007 gebaut.. klar wir haben vorher ein wenig gerechnet z.B. Wärmeausgleichsrechnungen gemacht + sinnvolle Dachüberstände festgelegt. Ergebnis: Selbst wenn heute draußen mal eine Woche deutlich über 30°C sind bleibt es innen bei 20-21°C. Klimaanlage, spezielle Kühlsysteme, Außendämmung, exotische Baumaterialen, geheimnisvolle Baukonstruktionen oder gasgefüllte Wärmedämmfenster .. alles Fehlanzeige - so etwas hätten wir gar nicht bezahlen können. Leider scheint auch die StiftungWarentest (siehe Ihre Baubücher) vergessen zu haben, dass man zu heiße Zimmer und hohe Heizkostenrechnungen leicht vermeiden kann wenn man mit statt gegen die Bauphysik baut.
@tanteherma: Die Kommentare sind immer chronologisch aufgeführt. Unter "Weitere Kommentare anzeigen" finden Sie alle Kommentare.
...wo ist diese Taste geblieben?...oder bin ich - immer noch - Compi-Anfängerin...ist woanders auffindbar?