Der graue Star und die altersabhängige Makuladegeneration lassen die Sehkraft schwinden. Neben bewährten Verfahren stehen auch neue Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Auch Augen altern und werden anfällig für Krankheiten. Mehr als die Hälfte der über 65-Jährigen leidet an grauem Star – die Augenlinse trübt sich ein. Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) schädigt den Bereich des schärfsten Sehens. Jedes Jahr erkranken 50 000 daran, betroffen sind rund 4 Millionen im Lande.
Farben verblassen, Lesen strengt an
Mit der Zeit werden die Fasern der Augenlinse weniger durchlässig für Licht. Die Linse wird trüb, verhärtet sich. Der graue Star (Katarakt) zeigt sich als fortschreitender Prozess. Neben Altersgründen können zum Beispiel starke Lichteinwirkung, Störungen der Linsenernährung, Diabetes oder Neurodermitis Auslöser sein. Betroffene schauen wie durch ein beschlagenes Fenster. Plötzlich sehen sie Flugzeuge am Himmel doppelt. Farben verblassen. Mitunter verändert sich die Brillenstärke in kurzen Zeitabständen. Lesen strengt an, erfordert stärkeres Licht. Verkehrsteilnehmer reagieren empfindlich auf Blendeinwirkung.
Medikamente gegen grauen Star gibt es noch nicht, aber eine Operationsmethode, die bei etwa 95 von 100 Eingriffen das Sehvermögen wieder herstellt, bei den restlichen teilweise: Es wird eine Kunstlinse eingesetzt. Wochen, Monate, manchmal Jahre nach der Operation kann ein „Nachstar“ auftreten: Linsenzellen wachsen auf die Linsenkapsel und trüben die Sehschärfe. Per Lasereingriff kann der Arzt die Zellablagerungen endgültig beseitigen.
Kunstlinsen für jeden Bedarf
Vor der Operation wird der nötige Brechwert der Kunstlinse berechnet. Trotz sehr guter Verfahren „bleibt mitunter ein kleiner Restfehler“, sagt Oberarzt Dr. Mike Holzer, Leiter der refraktiven Chirurgie, Universitätsaugenklinik Heidelberg. Als Kunstlinsen kommen „normale“ Monofokallinsen oder Sonderlinsen infrage wie torische, asphärische, akkommodative Linsen und Multifokallinsen, alle mit UV-Schutz.
Monofokallinsen „heilen“ den grauen Star, ermöglichen scharfes Sehen aber entweder nur in der Ferne oder in der Nähe. Die meisten Menschen mit Monofokallinse müssen mindestens eine Brille tragen – in der Regel für das Nahsehen. Bei einer Hornhautverkrümmung kann auch eine Brille für die Ferne erforderlich sein. Besteht eine leichte Hornhautverkrümmung, kann sie operativ ausgeglichen werden. Bei Werten über 1,5 Dioptrien eignen sich torische Linsen. Die asphärische Monofokallinse eignet sich besonders bei großen Pupillen. Mit ihr können sich das Kontrast- und Dämmerungssehen bei Dunkelheit verbessern und die Blendungsempfindlichkeit verringern.
Scharf sehen in allen Entfernungen
Eine Augenlinse verliert nach 45 bis 60 Jahren die Fähigkeit, Entfernungen automatisch einzustellen – ein Verlust der Anpassungsfähigkeit, Akkommodation genannt.
Akkommodative Kunstlinsen sollen das ausgleichen und stufenlos scharfes Sehen ermöglichen. Zwei Monofokallinsen unterschiedlicher Dioptrien werden hintereinander geschaltet. Durch den Augenmuskel soll sich der Abstand der beiden Optiken zueinander und der Brennpunkt verändern. „Diese seit Anfang 2009 in Europa zugelassenen Linsen sind interessant, aber im klinischen Alltag noch nicht angekommen. Einige Fragen sind ungeklärt. Bislang wird nur eine mäßige Verbesserung der Nahsehschärfe erzielt“, so Professor Thomas Kohnen, Universitätsaugenklinik Frankfurt.
Die Multifokallinse, bereits vor 20 Jahren entwickelt, ermöglicht ein relativ scharfes Sehen in allen Entfernungen. Sie besteht aus mehreren Ringsegmenten unterschiedlicher Brechkraft und verteilt das einfallende Licht auf mehrere Brennpunkte. Diese Linse „geht über das medizinisch Notwendige hinaus und optimiert das Sehen“, sagt Thomas Kohnen. „Aber sie führt noch zu einer Einbuße an Kontrastsehen beziehungsweise zu Informationsdefiziten“, sagt Professor Horst Helbig, Universitätsaugenklinik Regensburg. Durch den herabgesetzten Bildkontrast nimmt der Betroffene je nach Linse in der Dämmerung um Lichtquellen oft Lichtreflexe wie Lichthöfe wahr. Das und ein schlechteres Dämmerungssehen erschweren das Autofahren. Neue Techniken wie ein weicher Übergang zwischen Nah- und Fern-Brennpunkt haben solche Effekte aber bereits reduziert.
Bei einem Glaukom und bei Netzhauterkrankungen wie der Makuladegeneration dürfen Multifokallinsen jedoch nicht eingesetzt werden. „Es ist aber nicht die Regel, dass dies eingehalten wird. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Patienten nicht zufrieden sind und die Linsen wieder entfernt werden müssen“, warnt Professor Albert Augustin, Direktor der Augenklinik am Städtischen Klinikum in Karlsruhe.
Die torische Multifokallinse ist auch bei ausgeprägter Hornhautverkrümmung zu verwenden. Neben grauem Star, Kurz- und Alterssichtigkeit hilft sie auch, eine Hornhautverkrümmung ab 1,5 Dioptrien auszugleichen. Häufig lässt sich so eine Brille vermeiden. Das Gehirn braucht aber Zeit, sich auf die neue Optik einzustellen. Ob damit jeder klarkommt, ist unsicher.
Vor allem der Blauanteil des Lichts soll für lichtbedingte Schäden an der Netzhaut verantwortlich sein. Jede Linse kann neben einem UV-Filter auch einen Blaulichtfilter erhalten. „Das hängt davon ab, ob die Stelle schärfsten Sehens auf der Netzhaut bereits geschädigt ist. Studien zeigen, dass sich die altersabhängige Makuladegeneration ohne Blaufilter nach einer Operation tendenziell verschlechtert“, sagt Professor Albert Augustin.
Was die Operation kostet
Hat sich das Sehvermögen auf etwa 60 Prozent verschlechtert, bezahlt die Kasse einen Eingriff „in der medizinisch notwendigen Ausführung“ – aber nur die einfache Monofokallinse, ebenso die Operation. Alle anderen Linsen muss der Patient selbst bezahlen – pro Auge sind das zwischen 500 und etwa 1 600 Euro. Die Kosten für die Operation muss er ebenfalls selbst tragen: Das macht etwa 1 000 bis 1 500 Euro pro Auge, es gibt je nach Bundesland Unterschiede. Dabei ist die Implantationsmethode bei Mono- und Multifokallinsen weitestgehend gleich, bei Sonderlinsen ist sie anspruchsvoller.
Tipp: Es ist ratsam, vor einer Operation zur Kunstlinse eine Zweitmeinung einzuholen – es sei denn, Sie wollen nur die Leistungen der Kasse in Anspruch nehmen. Der Augenarzt sollte bei der Linsenwahl berücksichtigen, ob Sie eine Augenerkrankung wie ein Glaukom oder eine Hornhautverkrümmung haben, nachts häufig Auto fahren und bereit sind, eine Brille zu tragen.
Altersabhängige Makuladegeneration
Im Mittelpunkt der Makuladegeneration steht die winzige Makula, ein gelber Fleck. Die wenige Quadratmillimeter große Stelle ermöglicht solch komplexe Sehleistungen wie Lesen, Erkennen von Gesichtern und feinen Details, Unterscheiden von Farben. Was das Auge fixiert, wird auf die Makula abgebildet. Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist die Hauptursache für eine hochgradige Sehminderung bei Älteren. Sinneszellen sterben dabei ab. Ursachen dieser Augenkrankheit sind das Alter, aber auch Rauchen, einseitige Ernährung (arm an Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren), ständige Lichteinwirkung, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genetische Veranlagung. Sind Eltern betroffen, ist das Erkrankungsrisiko der Kinder erhöht. Bei AMD ist ein Teil des Immunsystems, das Komplementsystem, gestört.
Es gibt die trockene und die feuchte AMD, manchmal treten beide zugleich auf. Bei der trockenen AMD sterben die Sinneszellen langsam ab. Ist erst ein Auge betroffen, kann das gesunde die Schwäche häufig eine Zeit lang ausgleichen. Die Behandlung der trockenen AMD konzentriert sich derzeit darauf, Betroffene mit Lese- und Hörhilfen oder per Computer zu unterstützen.
„Ein Hilferuf der Netzhaut“
Bei der feuchten AMD nimmt die Sehfähigkeit bereits nach wenigen Monaten drastisch ab. Die Netzhaut produziert größere Mengen des Botenstoffs VEGF (vascular endothelial growth factor), erläutert Professor Frank G. Holz, Direktor der Universitäts-Augenklinik Bonn, „ein Hilferuf der Netzhaut, dass sie nicht richtig ernährt wird “.
VEGF bewirkt, dass krankhafte Blutgefäße aus der Aderhaut in die normalerweise gefäßfreie Makula einsprießen. Austretende Flüssigkeiten, Netzhautschwellung und Blutungen zerstören dort die Sinneszellen. Heilung ist derzeit nicht möglich. Der Prozess kann aber aufgehalten oder zumindest verlangsamt werden.
Je früher die Behandlung einsetzt, desto besser. Hemmstoffe (wie VEGF-Inhibitoren gegen Blutgefäßneubildung) blockieren das Wachstum der Gefäße, dichten sie bei den meisten Patienten ab: Sie werden in den Augapfel injiziert. Bei einigen wird die Gefäßneubildung nach wenigen Injektionen gestoppt, andere müssen Jahre behandelt werden. Zu den Hemmstoffen zählen Mittel wie Ranibizumab (Lucentis), Pegaptanib (Macugen), Bevacizumab (Avastin, siehe „Avastin oder Lucentis?“). Übrigens: Nur noch selten eingesetzt werden die Laserbehandlung (Veröden undichter Gefäße) und die photodynamische Therapie (in die Vene injiziertes laserlichtempfindliches Verteporfin lagert sich in der krankhaften Gefäßmembran ab). Die Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten sind meist besser.
-

Trübe Bilanz
- Wie gut beraten Augenlaser-Zentren? Oft erschreckend schlecht, zeigt unser Test. Was Interessierte wissen sollten, bevor sie sich für einen Eingriff entscheiden.
-
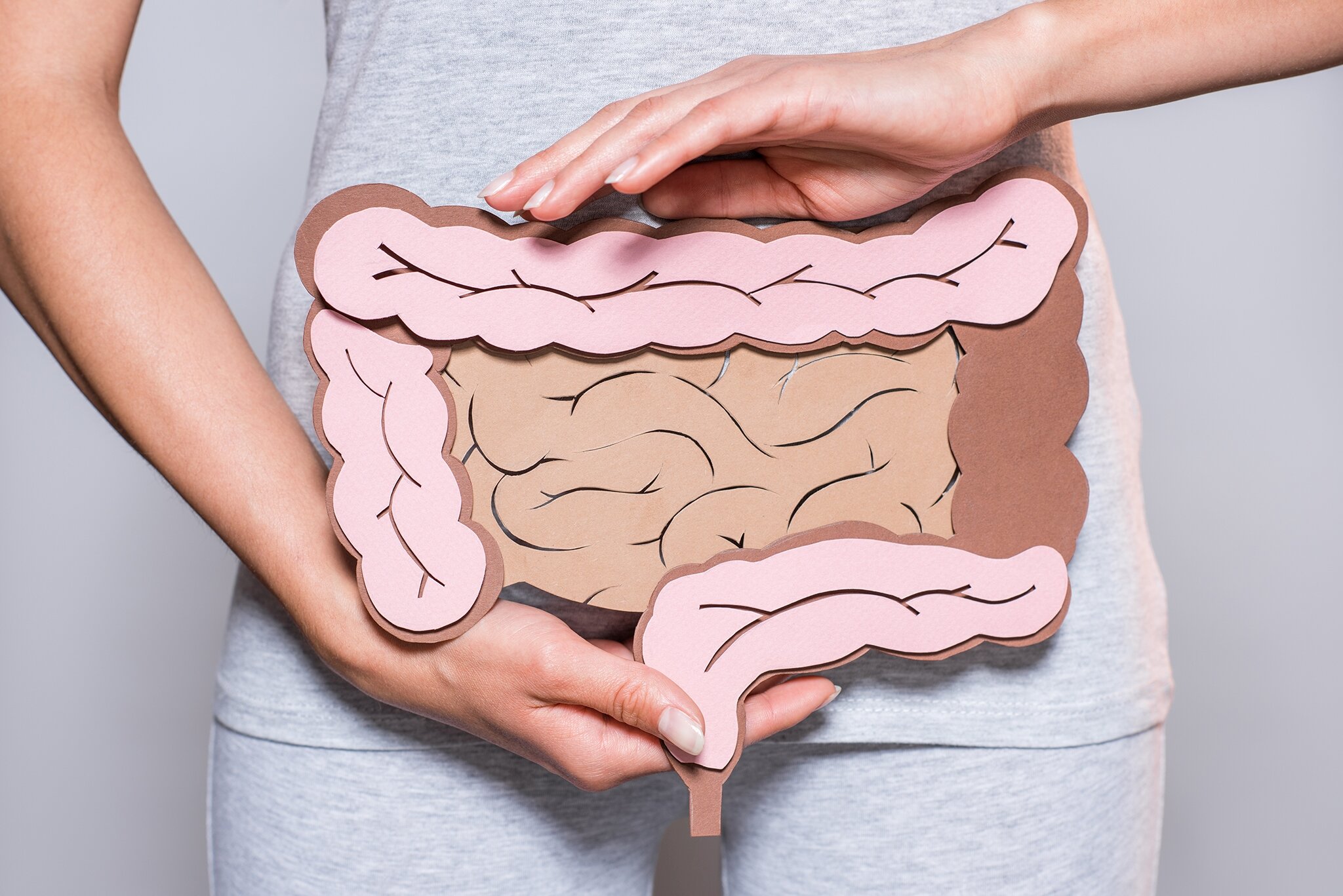
Früherkennung zahlt sich aus
- Die Zahl der Darmkrebsfälle ist rückläufig, auch dank Vorsorge. Neu: Frauen können nun wie Männer bereits ab 50 Jahren zum Screening. Wir informieren zu Möglichkeiten.
-

Hämorrhoidencremes sind tabu
- Dunkle Schatten unter den Augen stören. Wir sagen, welche Ursachen sie haben können, wie sie wieder verschwinden und auf welche Hilfsmittel Betroffene verzichten sollten.
Diskutieren Sie mit
Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.

Kommentarliste
Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.
Die trockene Form der Makuladegeneration ist derzeit augenheilkundlich nicht behandelbar. Um so mehr wundert es mich, dass naturheilkundliche Verfahren, wie die Augenakupunktur nach Boel aber auch die Klassische Akupunktur, mit keinem Wort erwähnt werden. Dass zu diesen Methoden derzeit nur Erfahrungen von Therapeuten und keine Studien existieren ist traurig und ein Manko.
Ich sehe aber nicht, dass sich das in nächster Zeit ändert.
Auf meiner Seite www.makuladegeneration-akupunktur.info habe ich versucht Informationen zur Makuladegeneration und zur Augenakupunktur nach Boel zusammenzutragen.
Anmerkung: dies ist eine Webseite meiner Arztpraxis.
Alles Gute
Klaus Schleusener, Karlsruhe
Kommentar vom Autor gelöscht.