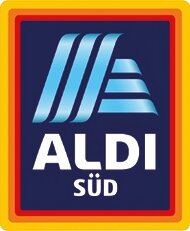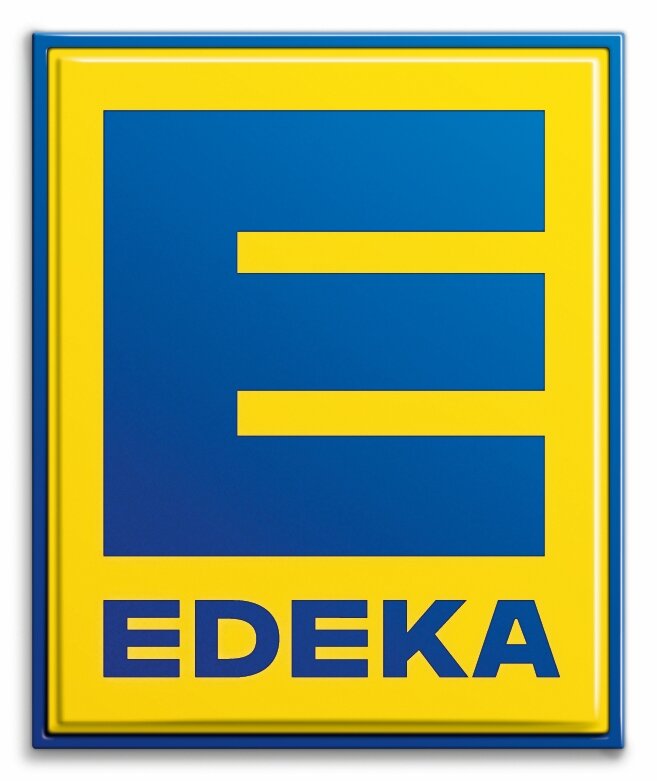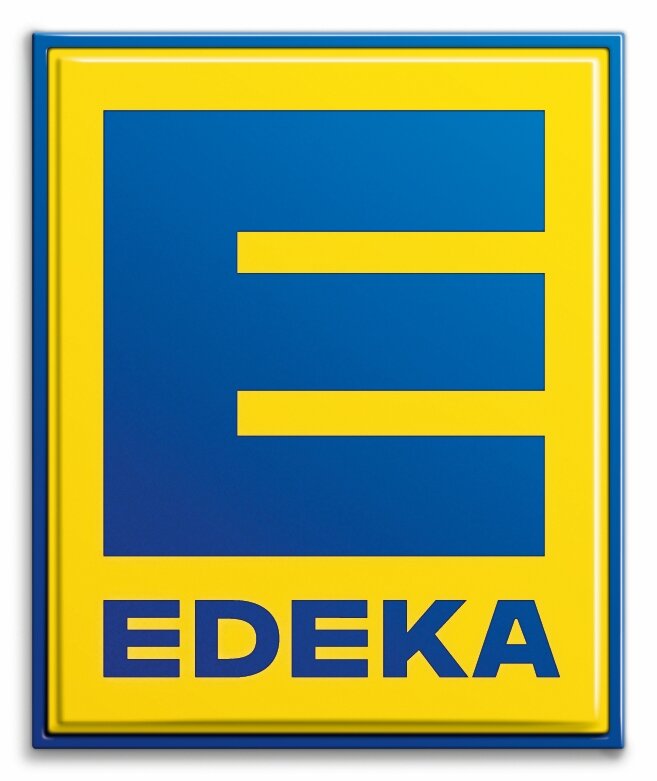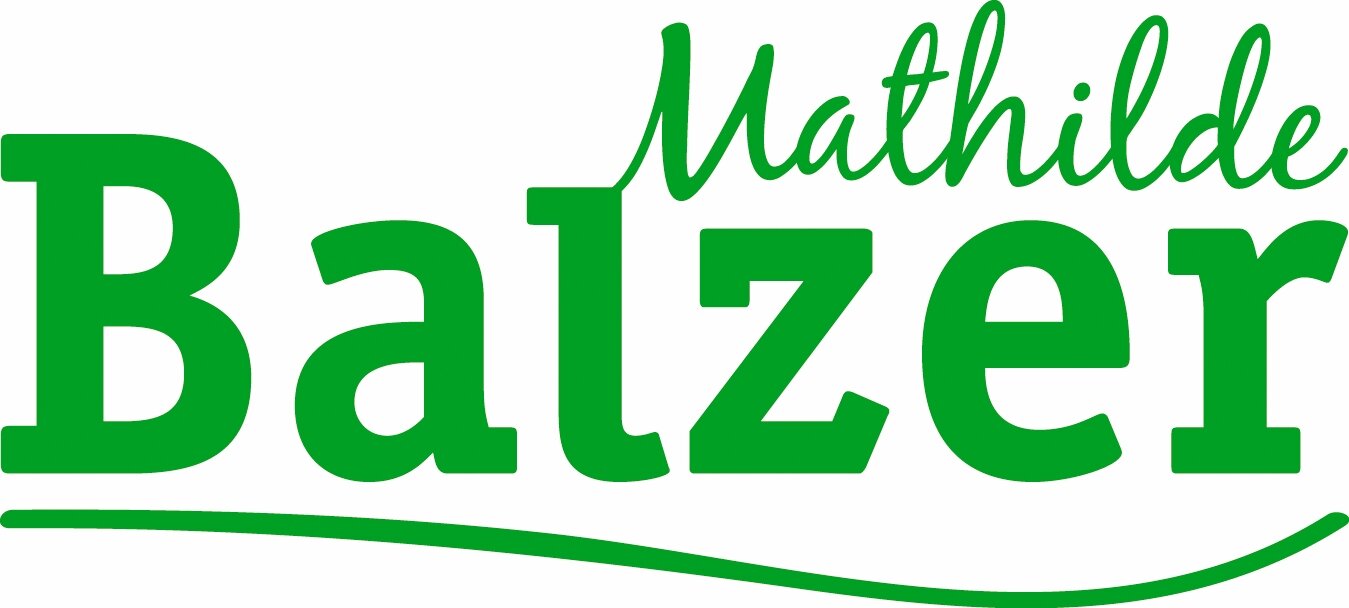So haben wir Putenfleisch getestet
Fleisch stammt von Tieren. Uns interessiert deshalb nicht nur die Qualität des Lebensmittels an sich, sondern auch wie die Bedingungen im Stall und im Schlachthof sind. Für unseren Test haben wir die Putenschnitzel unter anderem auf Keime untersucht und verkostet sowie bei allen Anbietern geprüft, wie stark sie sich fürs Tierwohl, für Umweltschutz und Arbeitsbedingungen in der Putenfleisch-Produktion einsetzen.
Unsere Prüfkriterien für die Fleischqualität
Im Test: 14-mal abgepackte frische Putenschnitzel, die wir nach bundesweiter Recherche im Handel ausgewählt haben. Drei Produkte tragen das Bio-Siegel. Wir kauften die Schnitzel im Februar 2025 ein. Die Preise ermittelten wir in einer Anbieterbefragung im August 2025.
Sensorisches Urteil: 40 %
Die sensorischen Prüfungen erfolgten am Verbrauchsdatum oder maximal zwei Tage davor. Fünf geschulte Prüfpersonen beschrieben Aussehen und Geruch des rohen Fleischs, beim im Bratschlauch zubereiteten Fleisch auch Geschmack, Textur und Mundgefühl. Der erarbeitete Konsens war Basis der Bewertung.
Die sensorischen Prüfungen wurden in Anlehnung an Methode L 00.90–22: Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung eines sensorischen Profils (Konsensprüfung) der ASU durchgeführt. Die Abkürzung ASU steht für Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach Paragraf 64 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Das im Konsens aller Prüfer der Gruppe verabschiedete Ergebnis enthielt keine Bewertungen, sondern lediglich abgestimmte Produktprofile, bei denen gegebenenfalls unterschiedliche Beschreibungen aus den Einzelprüfungen zuvor in der Gruppe verifiziert wurden.
Mikrobiologische Qualität: 25 %
Gesamtkeimzahl und Krankheitserreger, Hygiene- und Verderbniskeime: Wir untersuchten je ein Prüfmuster bei Probeneingang, drei weitere am Verbrauchsdatum oder maximal zwei Tage davor. Eine Mischprobe prüften wir auf antibiotikaresistente Keime: MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus), ESBL-Bildner (Extended Spectrum Beta-Lactamase) sowie bei ESBL-Positiven auf Colistin-Resistenz.
Folgende Methoden haben wir eingesetzt:
- In Anlehnung an ASU-Methoden prüften wir die aerobe mesophile Koloniezahl (Gesamtkoloniezahl), Salmonellen, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Koagulase-positive Staphylokokken, präsumtive Pseudomonaden, Milchsäurebakterien.
- ESBL-Bildner: nach Anreicherung identifizierten wir Enterobakterien, die Extended Spectrum Beta-Lactamasen bilden, mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS). Die Bestätigung erfolgte mittels Antibiogramm/Stempeltest.
- MRSA: Auf Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus prüften wir nach Anreicherung in Anlehnung an die ASU-Methode mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Die Bestätigung erfolgte kulturell.
- Colistin-Resistenz: Die als ESBL identifizierten und bestätigten Bakterien wurden mittels E-Test auf Colistin-Resistenz überprüft und die minimale Hemmkonzentration bestimmt. Hier wiesen wir keine Resistenzen nach.
Chemische Fleischqualität: 10 %
Wir bestimmten, wie viel Wasser beim Zubereiten im Backofen verloren geht, zudem ermittelten wir die Fettsäurezusammensetzung und das Wasser-Fleischeiweiß-Verhältnis. Wir prüften auf Rückstände von Antiparasitenmitteln, Antibiotika sowie den Schwermetallen Blei und Kadmium.
Folgende Methoden haben wir eingesetzt:
- Bratverlust: gravimetrisch nach standardisierter Zubereitung im Backofen.
- Fettsäureverteilung: in Anlehnung an die Methode der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft.
- Trockenmasse/Wassergehalt, Rohprotein: In Anlehnung an ASU-Methoden. Aus beidem wurde der Wasser-Fleischeiweiß-Quotient berechnet.
- Kokzidiostatika (Antiparasitenmittel): mittels Flüssigkeitschromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS).
- Hemmstofftest: in Anlehnung an die ASU-Methode.
- Tetracycline: mittels LC-MS/MS.
- Blei, Kadmium: Aufschluss und Messung in Anlehnung an Din-EN-Methode.
Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung: 10 %
Wir prüften die Schutzatmosphäre elektrometrisch, wenn ein Hinweis darauf vorhanden war. Alle Schutzatmosphären waren intakt. Zudem prüften wir Entsorgungs- und Recyclinghinweise sowie, ob eine Originalitätssicherung vorhanden war. Drei Fachleute prüften das Öffnen und Entnehmen.
Deklaration: 15 %
Wir beurteilten, ob die Verpackungsangaben korrekt und vollständig waren. Wir prüften Angaben zu Zubereitung, Lagerung, Herkunft, Nährwert. Drei Fachleute bewerteten Leserlichkeit und Übersichtlichkeit.
Weitere Untersuchungen
Wir bestimmten pH-Wert, Gesamtfettgehalt und Nicht-Proteinstickstoff. Den physiologischen Brennwert berechneten wir. Es gab keine Auffälligkeiten.
Folgende Methoden haben wir eingesetzt:
- pH-Wert, Gesamtfett und Nichtprotein-Stickstoff: in Anlehnung an die ASU-Methode.
- Physiologischer Brennwert: berechnet aus den analysierten Gehalten von Fett und Eiweiß gemäß Lebensmittelinformationsverordnung.
Abwertungen
Abwertungen sind in der Tabelle mit einem Sternchen *) gekennzeichnet. Lautete das sensorische Urteil Ausreichend, konnte das Stiftung-Warentest-Qualitätsurteil nur eine halbe Note besser sein. Hieß das mikrobiologische Urteil Ausreichend oder schlechter, konnte unser Stiftung-Warentest-Qualitätsurteil nur eine halbe Note besser sein.
Unsere Prüfkriterien für die Produktionsbedingungen
Im Test: Wir bewerteten das Engagement für Tierwohl, Umwelt und Soziales (Corporate Social Responsibility, CSR) der 14 Anbieter von den Putenschnitzeln im Warentest. Der Test lief von April bis Juli 2025.
Vorgehen
Per Fragebögen ermittelten wir das Engagement der Anbieter für Tierwohl, Umweltschutz und Arbeitsbedingungen bezogen auf das ausgewählte Produkt. Voraussetzung war das Offenlegen der Lieferkette bis zur Kükenzucht. Wir beurteilten die Unternehmensverantwortung auf Basis der Anbietervorgaben und Maßnahmen im jeweiligen Schlacht- und Mastbetrieb. Wir baten um Antworten, Belege und Nachweise für regelmäßige Kontrollen und Unterstützungsmaßnahmen in allen Prüfbereichen. Unabhängige Fachleute prüften die im Fragebogen gemachten Angaben im Rahmen eines Vor-Ort-Besuches im entsprechenden Mastbetrieb.
Tierwohl: 50 %
Wir fragten die Anbieter unter anderem nach einer Tierwohl-Einkaufsrichtlinie für Puten, Vorgaben zu umstrittenen Praktiken wie Schnabelkürzen sowie Zielen für den Bezug von Putenfleisch aus tierwohlfördernden Haltungsstufen. Wir legten etwa Wert auf eine tierschutzbezogene Lieferantenbewertung sowie Möglichkeiten zur Einsichtnahme in Tiergesundheitsdokumente. Vom Schlachtbetrieb ließen wir uns unter anderem Maßnahmen zur Stressreduktion der Tiere, die Dokumentation von Tiergesundheitsdaten und das Vorgehen bei kritischen Befunden und Verstößen zeigen. Beim Mastbetrieb bewerteten wir etwa Haltungssystem, Stallstrukturierung, Platzangebot und Regelungen zu Stallklima, Beschäftigungsmaterial, Einstreumanagement und Tiergesundheit.
Umweltschutz: 25 %
Wir legten Wert auf eine Lieferantenauswahl anhand ökologischer Parameter wie etwa Umweltmanagementsystem, Erfassung von Treibhausgasemissionen, Nutzung erneuerbarer Energien und ressourcenschonender Verpackung. Für den Schlachtbetrieb ließen wir uns unter anderem ökologische Zertifizierungen, Maßnahmen zum Wasser- und Energiemanagement sowie Klimaschutz aufzeigen. Für den Mastbetrieb bewerteten wir etwa Maßnahmen zur Reduzierung von Energie und Verbräuchen, zum Mist-Management sowie zur Förderung von Biodiversität.
Arbeitsbedingungen: 20 %
Wir fragten die Anbieter nach einer sozialorientierten Lieferantenauswahl, etwa ob sie Schlachtbetriebe mit Tarifbindung bevorzugen. Für den Schlachtbetrieb legten wir zum Beispiel Wert auf betriebliche Mitbestimmung und Beschwerdemöglichkeiten, Vertrags- und Lohngestaltung sowie Regelungen, um unangemessen lange Arbeitszeiten zu vermeiden. Wir fragten außerdem nach betrieblicher Gesundheitsförderung und Weiterbildungen.
Transparenz: 5 %
Wir bewerteten, ob die Anbieter ihre vollständige Lieferkette offenlegten, unsere Fragebögen beantworteten, Aussagen glaubhaft belegten sowie eine Überprüfung der gemachten Angaben durch einen Besuch des Putenmastbetriebs ermöglichten.