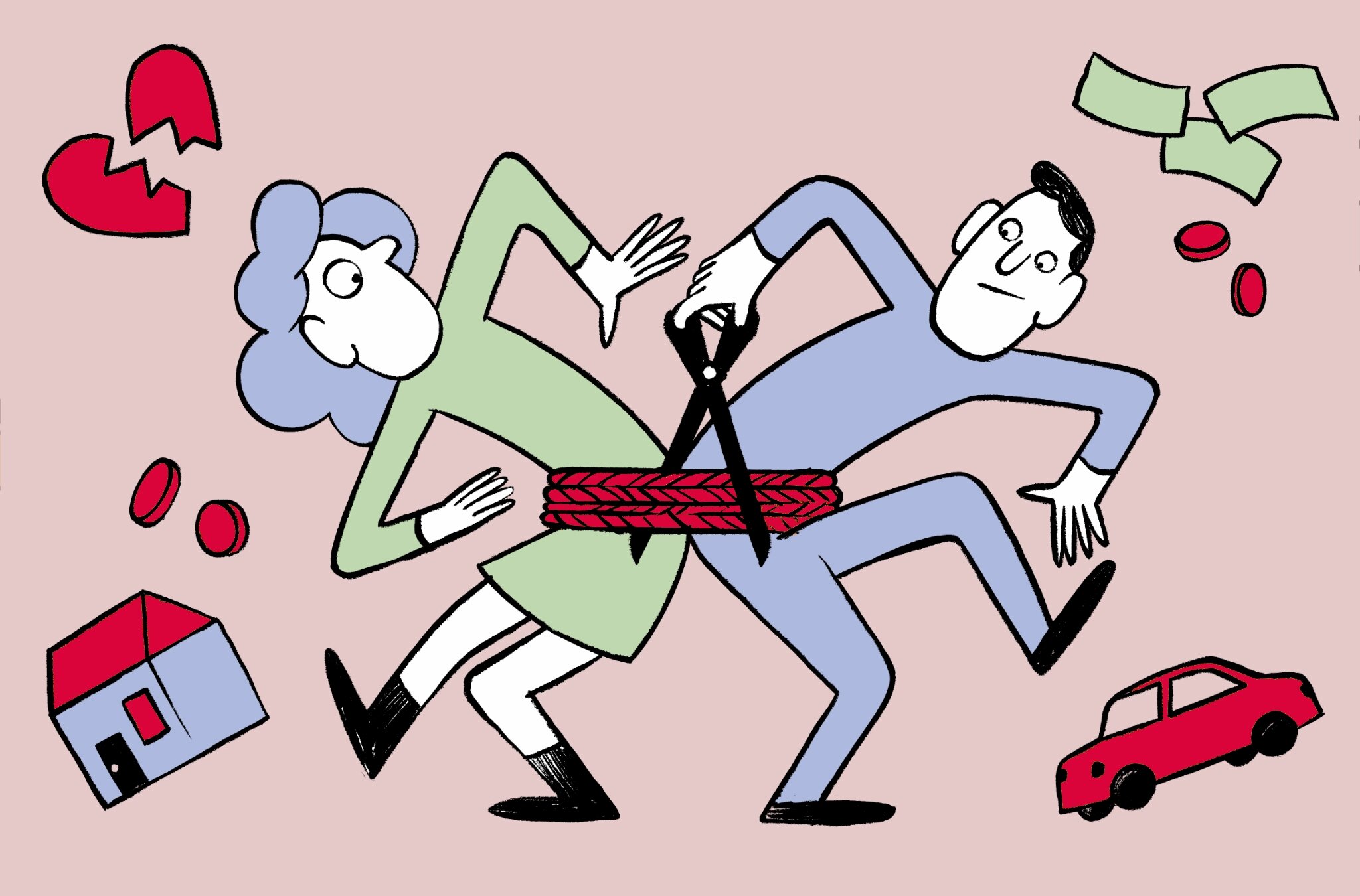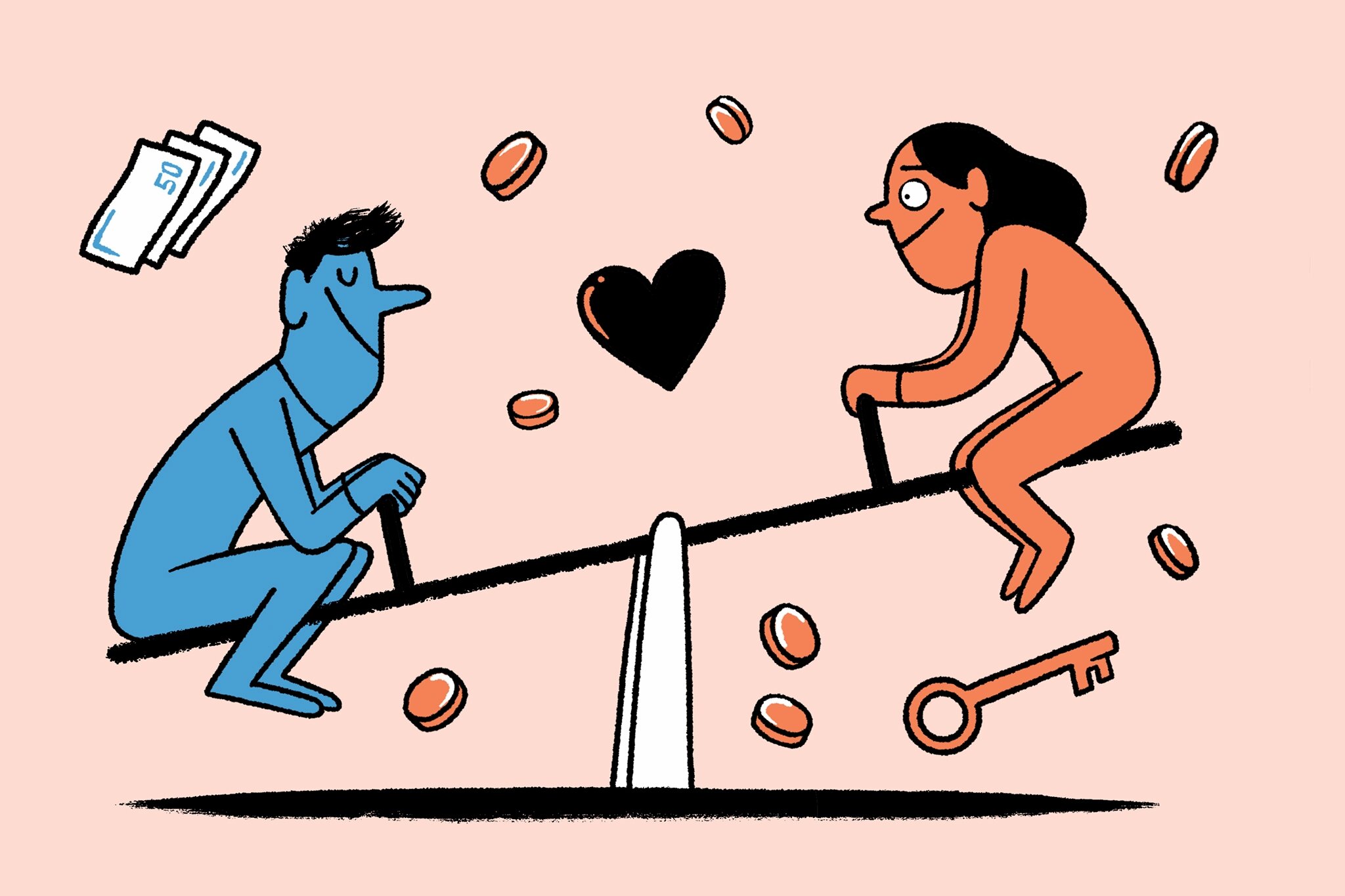Nein, das geht auf keinen Fall. Ein und derselbe Rechtsanwalt darf nie sowohl den einen als auch den anderen Partner vertreten. Das verbietet die Berufsordnung. Schließlich geht es um widerstreitende Interessen: Das, was für den einen gut ist, geht zwangsläufig zulasten des anderen. Das Verbot geht so weit, dass der von dem einen Partner beauftragte Rechtsanwalt den anderen auch nicht beraten oder Informationen herausgeben darf.
Parteiverrat. Ein Verstoß gegen diesen Grundsatz hat schwerwiegende Folgen für den Rechtsanwalt: Der Anwalt begeht Parteiverrat und damit eine strafbare Handlung. Außerdem verliert er seinen Anspruch auf Bezahlung.
Anwaltszwang. Eine Scheidung ganz ohne Rechtsanwalt funktioniert allerdings auch nicht. Mindestens einer der Partner muss sich vertreten lassen, weil nur ein Anwalt den Scheidungsantrag bei Gericht einreichen kann. Der Anwalt handelt auch in diesem Fall einzig und allein für die Person, die ihn beauftragt hat.
Geld sparen mit einem Anwalt. Der andere Partner muss sich nicht anwaltlich vertreten lassen, wenn sich beide über die angestrebten Scheidungsfolgen einig sind. Allerdings kann er dann im Verfahren keine eigenen Anträge stellen und muss es mehr oder minder über sich ergehen lassen. Sind sich Eheleute im Großen und Ganzen einig, lässt sich viel Geld sparen, wenn nur einer einen Anwalt einschaltet: unterm Strich leicht mehrere Tausend Euro.
Tipp: Anwalt benötigt, aber keinen an Ihrer Seite? In unserem Special Anwaltssuche erklären wir, wie Sie in vier Schritten eine gute Kanzlei finden und den Termin beim Experten am besten vorbereiten.
Gegen den Willen des anderen ist eine Scheidung nicht möglich
Doch! Eine Ehe kann natürlich auch gegen den Willen des Partners geschieden werden – und das auch nicht erst nach drei Jahren, wie ein anderer häufiger Irrtum in diesem Zusammenhang lautet.
Trennungsjahr. Damit eine Ehe geschieden werden kann, muss sie zerrüttet sein. Das wird bei einer einvernehmlichen Scheidung angenommen, wenn die Partner ein Jahr getrennt gelebt haben. Das Trennungsjahr soll sicherstellen, dass die Eheleute es wirklich ernst meinen mit der Scheidung und dass keine Aussicht mehr darauf besteht, dass sie sich wieder zusammenraufen.
Einseitige Zerrüttung. Will ein Partner die Scheidung, der andere aber nicht, wird erst nach einer dreijährigen Trennungszeit gesetzlich vermutet, dass die Ehe zerrüttet ist. Das heißt aber nicht, dass sie nicht schon vorher geschieden werden kann. Eine Scheidung ist möglich, wenn der Partner, der sich scheiden lassen will, nachweisen kann, dass die Ehe unter keinen Umständen mehr zu kitten ist. Es gibt nämlich auch eine einseitige Zerrüttung. Denn wie soll eine Partnerschaft funktionieren, wenn einer der beiden die Beziehung nicht mehr führen will? Eine Scheidung vor Ablauf der dreijährigen Trennungszeit kommt etwa in Betracht, wenn der scheidungswillige Partner seit geraumer Zeit mit jemand anderem zusammenlebt.