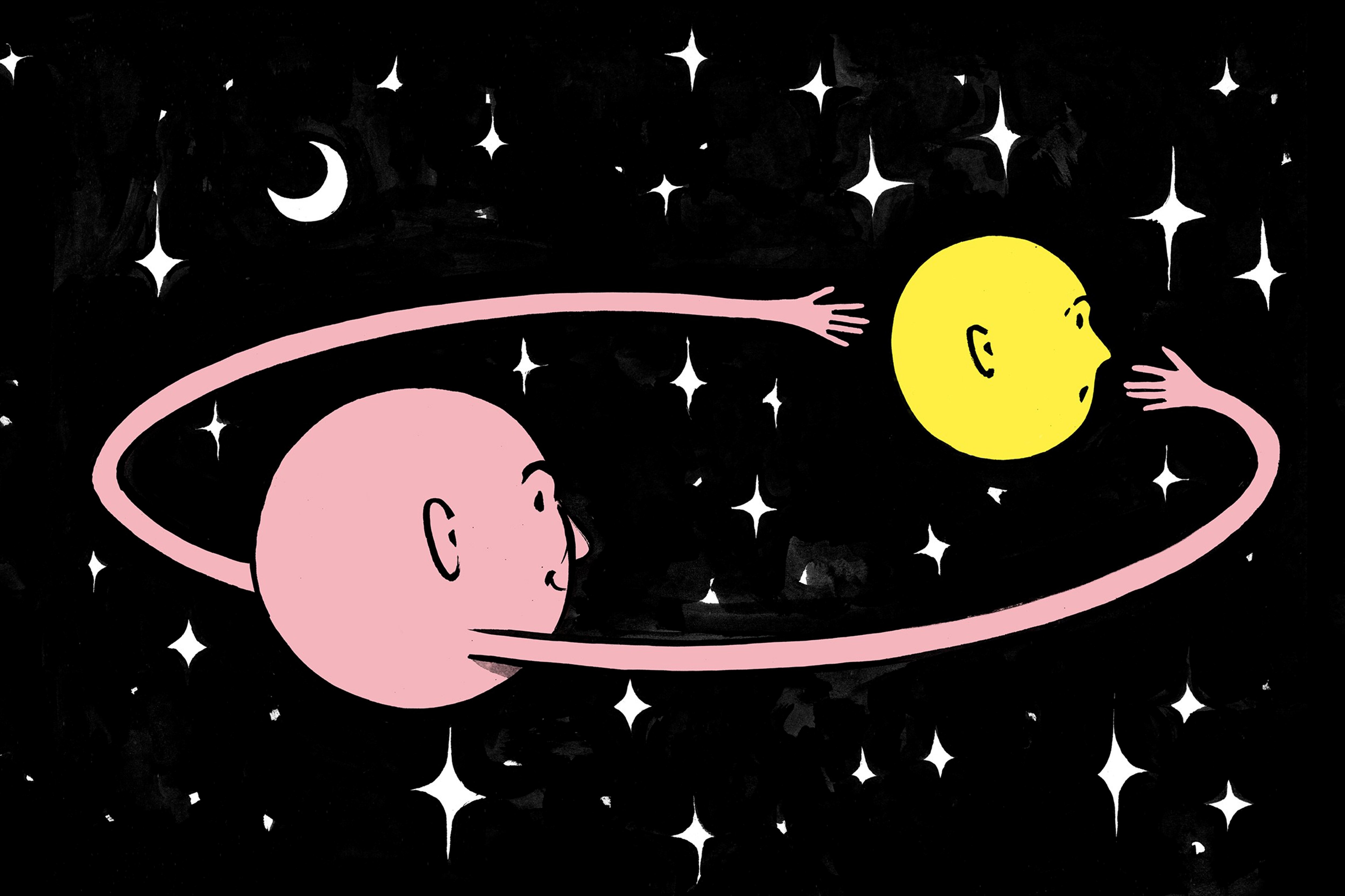
Zugewandt bleiben. Dies trotz Differenzen zu bewahren, kann verhindern, dass jemand weiter in Parallelwelten abdriftet. © Studio Pong
Verschwörungsdenken gefährdet die Gesundheit – und Beziehungen. Was Sie als Angehöriger tun können und was Sie besser vermeiden sollten.
Der Großvater, der die Covid-19-Impfung verweigert: Da werde den Menschen ein Chip implantiert. Zur Überwachung! Die Eltern, die Antibiotika für ihre Kinder kategorisch ablehnen, selbst bei schweren Mittelohrentzündungen: Damit wolle die Pharmaindustrie nur Profit machen. Der Glaube an Verschwörungen ist weit verbreitet – und er betrifft sehr oft den Bereich Gesundheit. Das war älteren Umfragen zufolge schon vor der Corona-Krise so. In der Pandemie wurde es schlagartig sichtbar.
Die Beziehung zu erhalten, ist möglich
Verschwörungsdenkende misstrauen oft generell wissenschaftlichen Methoden, setzen stattdessen auf dubiose Angebote selbst ernannter Heiler. Nicht selten zerbrechen langjährige Freundschaften oder gar Familien, wenn jemand in eine Parallelwelt entgleitet. Doch gerade der Kontakt zu Angehörigen kann auch eine Chance sein, ein weiteres Abdriften zu verhindern.
Was können erwachsene Kinder, Freunde oder Kollegen gegen Verschwörungsdenken ausrichten? Wie gehen sie am besten vor – und was sollten sie besser nicht tun? Wir haben zu den wichtigsten Fragen Tipps von Experten gesammelt. Sie erklären, warum hinter Verschwörungsdenken oft reale Probleme stehen, und nennen konkrete Sätze, mit denen Angehörige die Betroffenen noch erreichen – aber auch Grenzen ziehen können.
Angebot auswählen und weiterlesen
-

Ist die Vogelgrippe gefährlich für den Menschen?
- Erkrankte Milchkühe in den USA, einige Dutzend infizierte Menschen – die aktuelle Vogelgrippe-Welle beunruhigt die Fachwelt. Wie gefährlich ist sie? Ein Überblick.
-

Wer vom Grippeschutz profitiert
- Vor allem Risikopersonen wird geraten, sich ab Oktober gegen Influenza impfen zu lassen – ältere Menschen möglichst mit hoch dosierten oder verstärkten Impfstoffen.
-

Im Herbst an die Auffrischung denken
- Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder. Pünktlich zum Herbst stehen angepasste Impfstoffe zur Verfügung. Wem wird die Impfung empfohlen, wer kann verzichten?
Diskutieren Sie mit
Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.

Kommentarliste
Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.
Danke für die Diskussion, @Warentest, aber ich finde, Sie unterschätzen @ralle1.0’s Ansatz. “Die Wissenschaft” ändert sich ja auch in ihren Empfehlungen kontinuierlich-dialektisch -- und nicht immer dominieren auf demokratisch-transparente Weise die besten wissenschaftlichen Empfehlungen den Mainstream. Im Gesundheitswesen spezifisch hat ausserdem jeder kommerzielle Anbieter privatökonomische Interessen, die sich nicht unbedingt voll mit denes des Patienten oder der Gesellschaft decken: dies abzustreiten wäre naiv. Gesellschaftlich brauchen wir deshalb eher mehr als weniger Skepsis, eher mehr grundsätzliches persönliches Hinterfragen als weniger. Als Wissenschaftler sehen wir deshalb in der Abgrenzung zu irrationellen Verschwörungstheorien eine grosse, subjektiv-bestimmte Grauzone: https://resilience-blog.com/2024/03/14/in-praise-of-contrarian-thinking/
Vielen Dank für die Antwort, @Warentest! Es freut mich, dass Sie den Punkt anerkennen. Dennoch: Die Grenze zwischen "legitimer Skepsis" und "generellem Misstrauen" ist subjektiv und kann leicht als Mittel dienen, um berechtigte Kritik zu diskreditieren – ein Totschlagargument, das Dialog behindert.
Zu den Skandalen: Sie erwähnen, dass Vorfälle wie die Opioid-Krise nicht auf Deutschland übertragbar seien. Aber Contergan war ein rein deutscher Skandal, der Tausende behinderte Babys verursachte, und die Industrie lernte daraus? Teils, doch ähnliche Probleme persistieren: Denken Sie an den Lunapharm-Skandal mit gefälschten Medikamenten oder aktuelle Fälle bei Krebsmitteln, wo Zulassungen trotz Zweifeln erfolgten.
X hat keine Qualitätskontrolle, stimmt, aber es ermöglicht offenen Austausch, den der Mainstream oft meidet. Wissenschaftliche Quellen sind essenziell, doch sie haben eine eigene Bias, z.B. durch Pharma-Finanzierung. Daher gilt alle Quellen kritisch zu prüfen für echten Dialog.
@ralle1.0: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. In der Tat ist die Abgrenzung, wo Verschwörungsdenken beginnt, nicht einfach und eine kritische Haltung grundsätzlich legitim. Dieser Aspekt wird auch in dem Interview noch einmal betont. Steigert sich Skepsis aber zu einem generellen Misstrauen gegenüber ganzen Bereichen, wird es problematisch, für den Betroffenen selbst und für sein Umfeld.
Etwa, wenn nicht mehr nur eine bestimmte Impfung abgelehnt wird, vielleicht weil sie noch neu ist, sondern alle Impfungen oder gar „alle Ärzte“. Oder wenn generell staatlichen Stellen misstraut wird und Informationen ausschließlich von alternativen Quellen bezogen werden.
Wir stützen unsere Aussagen auf überprüfbare wissenschaftliche Quellen mit nachgewiesener Expertise. Diese ist bei Beiträgen in sozialen Medien oft nicht gegeben. Auf X etwa gibt es keine Qualitätskontrolle bezüglich der Inhalte. Daher sollten Nutzer den Inhalten dort mit besonderer Vorsicht begegnen.
Die von Ihnen benannten Vorfälle aus anderen Ländern sind uns bekannt. Sie lassen sich aber nicht auf das deutsche Gesundheitssystem übertragen. Im Gegenteil lernt die Wissenschaft auch aus solchen Vorfällen und ergreift vorbeugende oder korrigierende Maßnahmen. Auch deshalb gibt in Deutschland keine vergleichbare Opioid-Krise wie in den USA.
Ein guter Artikel, der wichtige Tipps gibt, wie man trotz Differenzen in Kontakt bleibt – das ist lobenswert! Denn Polarisierung hilft niemandem. Aber: Die Definition von "Verschwörungsdenken" ist zu breit. Skepsis gegenüber Pharma-Profiten oder Impfungen wird gleich mit absurden Theorien vermengt. Dabei gibt es reale Skandale, z.B. die Opioid-Krise oder unethische Tests von Pfizer in Nigeria. Das ignoriert der Text und pathologisiert berechtigte Zweifel als "Abdriften in Parallelwelten".
Statt nur den "Betroffenen" zurückzuholen, sollten wir echten Dialog fördern: Beide Seiten zuhören, Quellen prüfen und Unsicherheiten in der Wissenschaft anerkennen. Medien wie Warentest, die von sich behaupten objektiv zu sein, sind super, aber sie sollten auch alternative Perspektiven (z.B. von X) einbeziehen, ohne sie pauschal zu diskreditieren. So vermeiden wir, dass "Verschwörung" zum Totschlagargument wird. Lassen Sie uns Brücken bauen, nicht Gräben vertiefen.