Mithilfe verschiedener Untersuchungen, die aufeinander aufbauen, lässt sich bestimmen, welche Art der Harninkontinenz vorliegt.
- Anamnese: Ausführliches Gespräch über die medizinische Vorgeschichte, zum Beispiel gynäkologische Probleme, Geburten, Blasen- oder Darmerkrankungen. Vor dem Arzttermin Trinkmenge und Toilettengänge aufzeichnen (Miktionsprotokoll).
- Urindiagnostik: Hinweise auf Infektionen und andere Erkrankungen.
- Gynäkolgische Untersuchung: Beckenboden-Kontraktionskraft wird ertastet, die Vaginalschleimhaut begutachtet. Eventuell Ultraschalluntersuchung von Blase und Harnröhre.
Spezielle Untersuchungen können sich anschließen:
- Reflex- und Sensibilitätstest: Hinweise auf neurologische Ursachen.
- Urodynamische Untersuchung: Speicher- und Entleerungsfunktion der Blase wird getestet. Wie viel Flüssigkeit passt in die Blase? Wie reagiert die Blasenmuskulatur? Wann kommt es zum Harndrang? Wie sieht der Ruhe- und der Belastungsdruck der Harnröhre aus? Ergänzend kann eine Spiegelung der Harnröhre und der Blase erfolgen.
-

Vier diskrete Helfer bei Blasenschwäche
- Unsere Partnerorganisation VKI hat Einlagen für leichte und mittlere Blasenschwäche getestet. Wir nennen Ergebnisse und informieren, was Betroffenen sonst noch hilft.
-
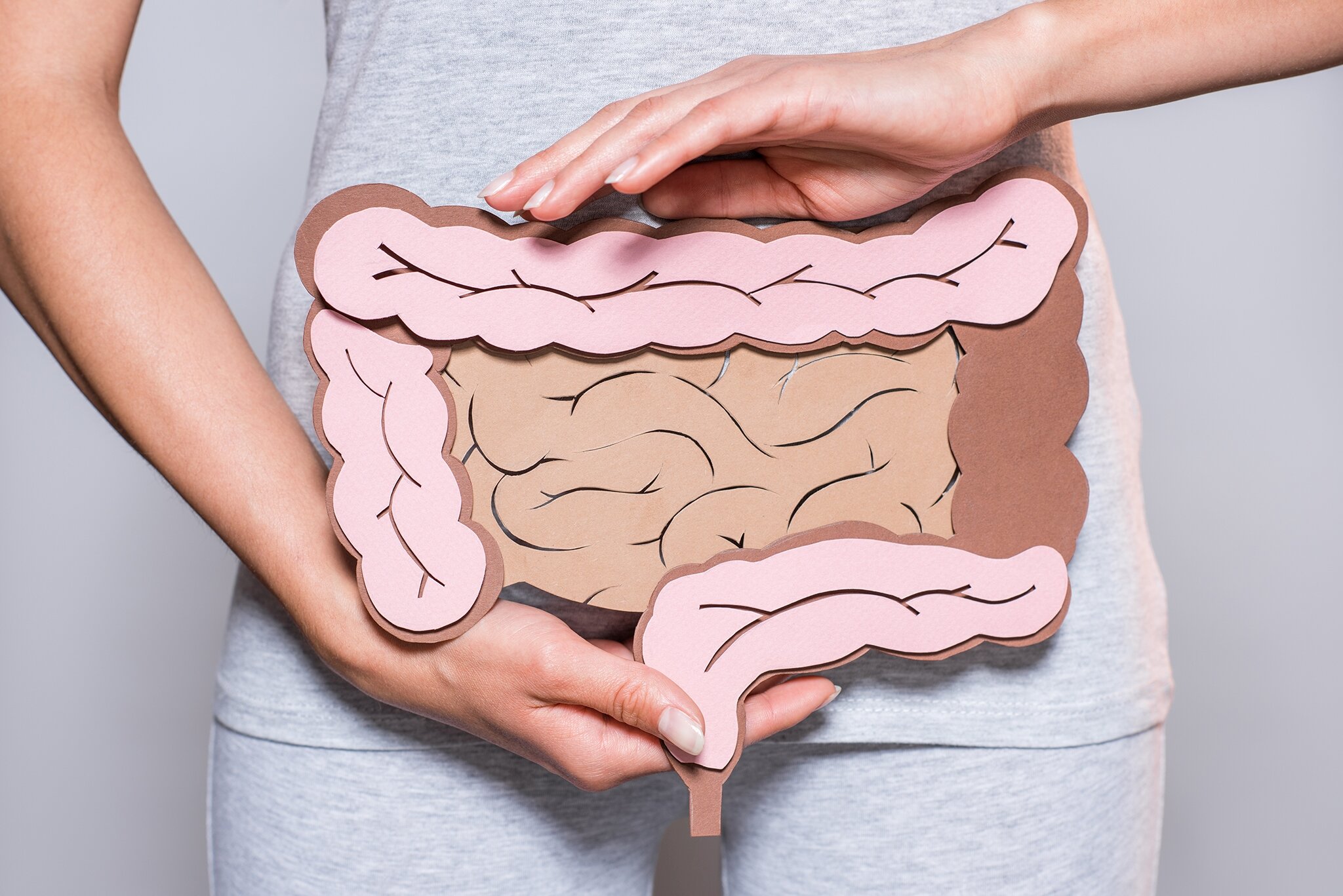
Früherkennung zahlt sich aus
- Die Zahl der Darmkrebsfälle ist rückläufig, auch dank Vorsorge. Neu: Frauen können nun wie Männer bereits ab 50 Jahren zum Screening. Wir informieren zu Möglichkeiten.
-

Schnelle Hilfe bei wunder Blase
- Was tun bei Harnwegsinfektionen? Neueste Studien zeigen: Cranberrysaft kann vorbeugen, für Mannose fehlen noch Belege. Und in vielen Fällen geht‘s auch ohne Antibiotika.
Diskutieren Sie mit
Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.
