Jetzt anmelden und 10% Rabatt auf die Flatrate im 1. Jahr erhalten!
Newsletter abonnieren Für alle, die es besser wissen wollen
Ja, ich möchte die Newsletter der Stiftung Warentest abonnieren und bin mit der Auswertung meiner Newsletternutzung einverstanden. Informationen zu den Newslettern und zum Datenschutz

Ausbildungsunterhalt. Bis zum Abschluss der Berufsausbildung müssen Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder aufkommen. © Getty Images / lockstock
Eltern müssen ihren Kindern eine Berufsausbildung finanzieren. Ewig zahlen müssen sie nicht – bei viel Wechsel oder ziellosem Herumstudieren endet ihre Pflicht.
Mit der Volljährigkeit ihres Kindes ist für Mütter und Väter die finanzielle Verantwortung in vielen Fällen noch nicht vorbei. Während eines Studiums oder einer Ausbildung haben Kinder im Allgemeinen weiterhin einen Anspruch auf Unterhaltszahlungen, solange sie in dieser Zeit noch nicht in der Lage sind, für ihren eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. Anders als zum Beispiel das Kindergeld endet der Anspruch auf Ausbildungsunterhalt nicht mit dem 25. Lebenjahr des Kindes, sondern läuft altersunabhängig bis zum Abschluss einer ersten Berufsausbildung. Bis dahin stehen die Eltern in der Pflicht. Je nach beruflichem Lebensweg des Kindes gibt es aber beachtliche Unterschiede, ob und wie lange die Eltern zahlen müssen.
Welche Rechte haben Eltern?
Eltern müssen ihr Kind in der Berufsausbildung unterstützen, gleichzeitig soll für sie selbst aber auch ausreichend Geld zum Leben übrig bleiben. Je nach Höhe ihres Einkommens wird der entsprechende sogenannte Selbstbehalt zur Existenzsicherung berechnet. Die Regelungen zum Ausbildungsunterhalt beruhen auf Gegenseitigkeit, und sollen beiden Parteien einen – entsprechend des Einkommens – angemessenen Lebensstandard ermöglichen.
Im Gegenzug für ihre finanzielle Beteiligung haben Eltern ein Recht, über den Verlauf des Studiums oder der Ausbildung informiert zu werden. Sie dürfen Tochter oder Sohn aber nicht vorschreiben, was für eine Ausbildung oder welches Studium sie absolvieren sollen. Ihr Kind darf unabhängig über seine Berufsausbildung entscheiden.
Wenn Eltern finanziell nicht in der Lage sind, ihren Kindern Unterhalt zu zahlen, weil sie selbst wenig verdienen oder zum Beispiel Bürgergeld beziehen, kann die Familie Förderungshilfen in Anspruch nehmen. Die gängigsten Optionen sind Bafög oder die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).
Verschiedene Familienkonstellationen: Wer muss zahlen?
Patchworkfamilien. Bei einer Trennung sind beide Elternteile anteilig und gemäß ihrem Einkommen weiter unterhaltspflichtig. Dabei ist es nicht unbedingt so, dass jeder die Hälfte zahlt. Die Höhe des Anteils wird einzeln nach dem jeweiligen Einkommen des Elternteils berechnet. Neue Ehe- oder Lebenspartner der Eltern stehen nicht in der Verantwortung. Es kann höchstens die Berechnung des Selbstbehalts geringfügig beeinflussen, wenn der neue Partner oder die Partnerin ein hohes Einkommen hat.
Verheiratete Kinder. Ist die Tochter oder der Sohn selbst verheiratet, müssen Mütter und Väter keinen Unterhalt mehr zahlen. Ein Ehe- oder Lebenspartner wird in der Rangfolge prinzipiell vor den eigenen Eltern in die Verantwortung gezogen. Sollte dieser aber nicht im Stande sein, den Unterhalt während der Berufsausbildung zu finanzieren, sind weiterhin die Eltern dran (§ 1608 BGB).
Wie wird der Unterhalt berechnet?
Der Anspruch auf Ausbildungsunterhalt für volljährige Kinder ist genau wie für Minderjährige gesetzlich geregelt. Ergänzend gelten die Richtlinien der sogenannten Düsseldorfer Tabelle, die die Höhe des Unterhalts nach Alter des Kindes und Einkommen der unterhaltspflichtigen Eltern aufschlüsselt.
Aktuell bewegen sich die Unterhaltsansprüche für über 18-Jährige zwischen 693 und 1 386 Euro pro Monat. Sollten Tochter oder Sohn noch Kindergeld bekommen, wird es von der Summe abgezogen. Kindergeld gilt als Einkommen des Kindes. Wohnt das Kind auswärts, hat es einen höheren Unterhaltsanspruch, als wenn es noch im Elternhaus lebt.
Genaue Zahlen zum Ausbildungsunterhalt lassen sich pauschal schwer nennen, weil viele verschiedene Faktoren in die Summe hineinspielen. Zunächst basiert der Unterhalt auf dem Einkommen der Eltern, aber auch ein bestehendes Vermögen des Kindes wirkt sich aus, ob es zu Hause wohnt oder ob es weitere unterhaltsberechtigte Geschwister hat. Alles führt zur Erhöhung oder Minderung des Anspruchs.
Der Unterhaltsbedarf von Studierenden, die nicht bei einem oder beiden Elternteilen wohnen, beträgt in der Regel 990 Euro pro Monat. Davon sind 440 Euro für Unterkunft und Nebenkosten vorgesehen (Düsseldorfer Tabelle, Anm. IV). Studierende, die im elterlichen Haushalt leben und keine zusätzlichen Mietkosten und keine Ausgaben für einen eigenen Haushalt haben, benötigen allgemein weniger Unterhalt.
Unterhalt urkundlich festhalten
Die Unterhaltsverpflichtung für Tochter oder Sohn kann man in einem sogenannten Unterhaltstitel urkundlich festhalten. Auf dieser Grundlage kann bei Nichtzahlung des Unterhalts eine sofortige Zwangsvollstreckung beantragt werden. Beim Jugendamt erhalten junge Menschen einen Unterhaltstitel bis zur Volljährigkeit kostenlos, notariell kostet er hingegen etwas. In beiden Fällen können die Unterhaltsberechtigten das Dokument allerdings nur bekommen, wenn die unterhaltszahlenden Elternteile zustimmen. Verweigern sie das, ist die Durchsetzung eines Unterhaltstitels nur vor Gericht möglich – mit entsprechenden Kosten, auch weil man beim Familiengericht bei Unterhaltsverfahren immer eine Anwältin oder einen Anwalt einschalten muss.
Besteht bereits ein Unterhaltstitel und ein Kind wird volljährig, verliert er nicht automatisch seine Wirkung, sondern ist weiterhin vollstreckbar. Die Eltern bzw. das Elternteil können einen bestehenden Unterhaltstitel aber anpassen lassen. Dann wird der Anspruch des Kindes erneut geprüft, und die Höhe wird unter den veränderten Umständen neu berechnet. Das ist ausschließlich über eine Abänderungsklage beim Familiengericht möglich.
Berufsnahe Einnahmen werden verrechnet
Neben dem Kindergeld wird auch ein Ausbildungsgehalt oder eine Praktikumsvergütung mit dem Unterhaltssatz, zu dem Eltern verpflichtet sind, verrechnet. Zudem ist es möglich, dass Eltern den Unterhalt nicht ausschließlich in Form von Geld, sondern auch durch Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Kleidung, Möbeln oder Ähnlichem leisten. Mit Erreichen der Volljährigkeit darf der Unterhalt aber nicht mehr allein durch diese Naturalleistungen und die Betreuung des Kindes erfolgen, sondern Eltern müssen auch Geldunterhalt zahlen.
Kosten für die Pflege- und Krankenversicherung und eventuelle Semester- oder Studiengebühren werden nicht als Teil des Unterhalts gerechnet und müssen von den Eltern ebenfalls gezahlt werden.
Nebenjobs
Wenn es während des Studiums oder der Ausbildung finanziell knapp aussieht, klingt ein Nebenjob naheliegend. Auszubildende oder Studierende sind aber nicht verpflichtet, neben ihrer Berufsausbildung zu arbeiten, da diese als Vollzeitbeschäftigung eingestuft wird. Eine zusätzliche Erwerbstätigkeit gilt nicht als zumutbar. Das gilt auch für Einkünfte durch Arbeit während der Ferien. Der Fokus soll auf der Ausbildung liegen, und ein Nebenjob soll keine Verzögerung des Abschlusses zu Folge haben. Wer sich durch Jobben etwas dazuverdienen will, darf das verdiente Geld in der Regel behalten, und es hat keinen Einfluss auf den Unterhalt.
Unterhaltsanspruch je nach Ausbildungsweg
Allgemein haben junge Erwachsene bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss Anspruch auf Unterhalt durch ihre Eltern. Aber nicht in allen Fällen müssen die Eltern wirklich zahlen. Eigenes Einkommen zum Beispiel kann den Unterhaltsanspruch aufheben. Beispiele dafür:
Berufsausbildung. Bis zum ersten Abschluss besteht prinzipiell ein Anspruch auf Unterhalt, eine Ausbildungsvergütung wird aber mit dem Unterhaltsanspruch verrechnet. Lebt das volljährige Kind im elterlichen Haushalt, wird von der Vergütung vor der Anrechnung der „ausbildungsbedingte Mehrbedarf“ abgezogen, der zum Beispiel Fahrtkosten und Lernmaterialien deckt. Diese Pauschale beträgt aktuell 100 Euro monatlich. Bekommt der oder die Auszubildende mehr Gehalt, als der Unterhaltssatz laut Düsseldorfer Tabelle beträgt, müssen Eltern nichts mehr sponsern. Ist der Verdienst geringer, müssen sie zuzahlen.
Studium. Ein Unterhaltsanspruch besteht, wenn es sich um ein Erststudium handelt. Auch ein Masterstudium im Anschluss an einen Bachelor gehört dazu, so lange beide Studiengänge inhaltlich und zeitlich Teil eines einheitlichen Berufswegs sind.
Studium nach Ausbildung oder andersherum. Unterschiedlich. Bilden Ausbildung und Studium inhaltlich eine einheitliche Berufsausbildung, ja. Ansonsten nicht, weil bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt.
Promotion. In der Regel nicht, da bereits ein Abschluss vorliegt. Ausnahmen können in Fachgebieten bestehen, in denen eine Promotion üblicherweise zum Berufsbild gehört.
Zweitstudium oder Ausbildung zum Ergreifen eines zweiten Berufswegs. Nein. Ein Unterhaltsanspruch besteht nur bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung.
Ausbildungsunterhalt bei anderen Tätigkeiten
Praktika. In Zeiten von Praktika als Teil des Studiums haben Kinder prinzipiell einen Unterhaltsanspruch gegenüber ihren Eltern. Bei anderen Praktika ist entscheidend, ob diese als Teil der Berufsausbildung angesehen werden können.
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst oder andere Freiwilligendienste. Im Allgemeinen kein Anspruch auf Unterhalt, da Freiwilligendienste nicht Teil einer Ausbildung sind. Es besteht aber in der Regel weiterhin ein Anspruch auf Kindergeld, und es gibt die Möglichkeiten wie Wohngeld zur finanziellen Unterstützung. Ausnahmen gibt es außerdem, wenn zum Beispiel ein FSJ dazu dient, ein Kind direkt auf die geplante Berufsausbildung vorzubereiten.
Gap Year, Work and Travel oder Au-Pair-Tätigkeit. Kein Unterhaltsanspruch, da es meistens ein eigenes Einkommen gibt und die Zeiträume in der Regel über eine Orientierungsphase hinausgehen.
Was zählt zur ersten Berufsausbildung?
Eltern müssen ihren Kindern nur eine Ausbildung bezahlen. Die Ausbildung kann allerdings mehrere Teile umfassen. Die Frage, ob im zweiten Teil auch noch gezahlt werden muss, kann sich zum Beispiel stellen, wenn das Kind nach dem Abschluss einer Ausbildung studiert. Dann ist entscheidend, ob beides zusammen als einheitliche Berufsausbildung eingestuft werden kann. Wenn ja, müssen die Eltern zahlen, wenn nein, nicht.
Die genauen Umstände zum Unterhaltsanspruch bei einer Kombination aus Ausbildung und Studium lassen sich nur im Einzelfall beurteilen. Es gibt Gerichtsurteile, an denen man sich orientieren kann:
Kein Geld für Studium nach Ausbildung. Die Tochter machte zuerst eine Ausbildung zur Bankkauffrau, dann studierte sie Wirtschaftspädagogik, um Lehrerin für berufsbildende Schulen zu werden. Ihr Studium gilt als Zweitausbildung, weil inhaltlich und zeitlich kein ausreichender Zusammenhang zwischen den beiden Ausbildungsphasen besteht. Der Vater muss für das Studium keinen Unterhalt zahlen, entschied der Bundesgerichtshof (Az. XII ZB 192/16).
Nach erfolgloser Arbeitssuche kein Unterhaltsanspruch für Zweitausbildung. Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm (Az. 7 UF 18/18) müssen Eltern nicht für das Psychologiestudium ihrer Tochter zahlen, nachdem sie als Bühnentänzerin keinen Arbeitsplatz finden konnte. Die Vorbildung zu einem Beruf müssen sie ermöglichen, aber die lag bereits vor. Alles, was darüber hinausgeht, gilt als Zweitausbildung. Dass die Tochter als Tänzerin keine Anstellung fand, ändert nichts daran. Nur in Ausnahmefällen wären die Eltern weiter unterhaltspflichtig, zum Beispiel wenn der Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht ausgeübt werden kann.
Kein Unterhalt für Medizinstudium nach Ausbildung. Nach dem Abitur bewarb sich die Tochter auf ein Medizinstudium, es dauerte aber sieben Jahre, bis sie einen Studienplatz bekam. In der Zwischenzeit machte sie eine Lehre als anästhesietechnische Assistentin und arbeitete dann in diesem Beruf. Zum Studium forderte sie Unterhalt von ihrem Vater nach vielen Jahren ohne Kontakt zu ihm. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Tochter keinen Unterhalt für das Studium bekommt (Az. XII ZB 415/16). Zwischen den Ausbildungsstufen bestand zwar ausreichend Bezug, aber laut dem Urteil sei es dem Vater nicht zuzumuten, noch einmal Unterhalt zu zahlen, weil er nicht mit dem Studium der Tochter rechnen konnte und durch einen Hauskauf mit mehreren Krediten bereits andere finanzielle Verpflichtungen hatte.
Erste Ausbildung entsprach nicht Neigungen und Fähigkeiten des Kindes. In Ausnahmen muss auch eine zweite Berufsausbildung von den Eltern finanziert werden, wenn die Erstausbildung auf einer deutlichen Fehleinschätzung der Begabung des Kindes beruhte oder die Berufswahl durch Zwang der Eltern getroffen wurde. Das wurde vom Oberlandesgericht Koblenz im Rahmen von zwei Gerichtsurteilen anerkannt (Az. 13 WF 650/00; 664/00). Fehleinschätzung oder Zwang waren allerdings in beiden Fällen nicht eindeutig belegbar, weshalb beide Kläger für ihre zweite Berufsausbildung dann doch keinen Unterhalt bekamen.
Richtungsweisendes Urteil für Haupt- und Realschüler
Der Unterhaltsanspruch bei einem Studium nach einer vorherigen Ausbildung gilt für Absolventen, die „nur“ einen Haupt- oder Realschulabschluss haben, prinzipiell nicht. Nach diesen Schulabschlüssen ist im Gegensatz zum Abitur ein Studium nicht grundsätzlich das Ziel.
Hierzu gab es inzwischen allerdings ein richtungsweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs, das Haupt- und Realschüler Abiturienten praktisch gleichstellt (BGH, Az. XII ZR 54/04). Der Kläger hatte nach seinem Realschulabschluss zunächst eine Maurerlehre abgeschlossen und machte im Anschluss die Fachhochschulreife. Nach dem Zivildienst bestand er die Aufnahmeprüfung für den gehobenen Polizeidienst. Diese Ausbildung brach er ab und begann dann Architektur zu studieren. Für das Studium wurde ihm vom BGH weiterhin ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt zugesprochen. Die Richterinnen und Richter argumentierten, dass es in Anbetracht des komplexen Bildungssystems nicht angemessen sei, an einer starren Ausbildungsreihenfolge festzuhalten. Zudem könne man nicht erwarten, dass Schülerinnen und Schüler zum Schulabschluss schon genau wissen, welches Berufsziel sie anstreben. Das sei auch mit Blick auf die nötige Flexibilität am Arbeitsmarkt nicht praktikabel. Junge Erwachsene sollten die Freiheit haben, sich auszuprobieren und sich umentscheiden zu dürfen. In diesem Fall hatte der Student während seiner Ausbildungslaufbahn das nötige Engagement gezeigt und durch sein Architekturstudium demonstriert, dass er als Maurer sein Potenzial noch nicht voll entfaltet hatte.
Auch Haupt- und Realschüler können also unter Umständen bei einem späteren Studium Ausbildungsunterhalt von ihren Eltern bekommen.
Rechte und Pflichten für Tochter oder Sohn
Unendlich lange kann man sich ein Studium nicht von den Eltern finanzieren lassen. Jugendliche und junge Erwachsene sind im Rahmen der sogenannten „Ausbildungsobliegenheit“ verpflichtet, sich aktiv um ihre Berufsausbildung zu kümmern und diese zielgerichtet durchzuführen. Nur so lange bekommen sie auch Unterhalt. Es wird ihnen dabei eine gewisse Zeit zur beruflichen Orientierung gestattet, ebenso wie die Möglichkeit für Studien- oder Ausbildungsplatzwechsel, solange diese aus guten Gründen und in einem angemessenen zeitlichen Rahmen stattfinden. Der genaue Kulanzbereich für einen Wechsel ist nicht einheitlich geregelt, liegt aber ungefähr bei 2-3 Semestern oder bis zur Hälfte der Ausbildungszeit.
Regelstudienzeit
Auch ein Überschreiten der Regelstudienzeit bedeutet kein direktes Erlöschen des Unterhaltsanspruchs. Hier bezieht man sich in der Regel stattdessen auf die übliche Studiendauer eines Studiengangs, um zu beurteilen, ob ein Studierender seine Berufsausbildung angemessen zielstrebig bestreitet. Verzögerungen zum Beispiel durch Auslandssemester oder Praktika im Studium gelten als sinnvolle Betätigungen und berechtigte Gründe für eine verlängerte Studienzeit. Während Wartesemestern besteht hingegen kein Unterhaltsanspruch, weil das Kind in dieser Zeit dazu in der Lage ist, selbst erwerbstätig zu sein.
Vom Abschluss zum Job
Nach dem Abschluss haben frischgebackene Absolventinnen und Absolventen noch für drei Monate einen Anspruch auf Unterhalt von ihren Eltern. Das soll es ihnen ermöglichen, in der Übergangszeit nach der Uni ohne Existenzsorgen einen Job zum Berufseinstieg zu finden. Beim Abbruch eines Studiums oder einer Ausbildung wird diese Frist ebenfalls gestattet. Danach erlischt aber der Anspruch auf Unterhalt, weil dann vom Kind erwartet werden kann, zu arbeiten und sich selbst zu finanzieren. Nach dem Ablauf der Bewerbungsfrist stehen die Eltern nicht mehr in der Pflicht.
Unterbrechungen der Ausbildung
Krankheit. Auch Auszubildende oder Studierende sind mal länger krank. Dabei muss der Ausbildungsunterhalt weitergezahlt werden. Der Unterhaltsanspruch erlischt erstmal nicht, besteht allerdings unter der Bedingung, dass sich die Erkrankten entsprechend behandeln lassen, um das Studium oder die Ausbildung nach Möglichkeit fortzuführen. Auszubildende erhalten sechs Wochen lang weiter Gehalt, dann können sie Krankengeld beantragen. Im Gegensatz dazu haben Studierende allgemein keinen Anspruch auf Krankengeld oder Sozialhilfe. Außerdem ist wichtig zu wissen, dass nach mehr als dreimonatiger Krankheit kein Bafög mehr gezahlt wird. Bei längeren Erkrankungen während des Studium kann es deshalb sinnvoll sein, ein Urlaubssemester zu beantragen. Bei längeren, krankheitsbedingten Unterbrechungen bekommt man kein Bafög, es besteht aber ein Anspruch auf Sozialleistungen. Betroffene sollten sich an die zuständigen Beratungsstellen wenden.
Schwangerschaft. Muss man wegen einer Schwangerschaft oder der Betreuung seines Kindes das Studium oder die Ausbildung unterbrechen, bekommt man zunächst weiter Unterhalt. Unter Umständen müssen aber nicht nur die eigenen Eltern zahlen, sondern zum Beispiel auch der Partner. Genau wie im Krankheitsfall gibt es nach Ausbildungsunterbrechungen von mehr als drei Monaten kein Bafög mehr. Stattdessen besteht möglicherweise ein Anspruch auf Bürgergeld, der konkrete Anspruch lässt sich aber nur im Einzelfall beurteilen, da zum Beispiel ein Urlaubssemester im Studium nur in ganzen Semestern möglich ist, und dann auch rückwirkend gilt. Die Fristen für die Beurlaubung und für Anträge sind bundesweit nicht einheitlich. Betroffene können sich darüber bei den zuständigen Beratungsstellen informieren. Außerdem können Schwangere während Ausbildungsunterbrechungen Sozialleistungen wie Elterngeld oder Mutterschaftsgeld zu beantragen. Wenn der oder die Unterhaltsberechtigte die Berufsausbildung infolge einer Babypause später wiederaufnimmt, besteht laut eines Urteils des Bundesgerichtshofs trotz der Unterbrechung weiter ein Recht auf Ausbildungsunterhalt (Az. XII ZR 127/09).
Durch körperliche oder psychische Beeinträchtigungen kann es länger dauern
Es kommt vor, dass Studierende oder Auszubildende aus Gründen, die im Zusammenhang mit einer vorliegenden Einschränkung oder Behinderung stehen, ihre Berufsausbildung abbrechen oder unterbrechen. Da die Hintergründe individuell verschieden sind, kann man nur im Einzelfall beurteilen, was das für ihren Anspruch auf Unterhalt bedeutet. Die folgenden Beispiele zeigen zwei unterschiedliche Ergebnisse:
Beispiel 1. Eine Schülerin mit Schwerbehinderung machte nach dem Beenden der Förderschule einen Hauptschulabschluss und erhielt damit einen berufsqualifizierenden Abschluss. Danach strebte sie einen Realschulabschluss an, erschien aber nicht zu ihren Prüfungen, reichte notwendige Arbeiten nicht ein und schaffte den Abschluss dementsprechend nicht. Sie bekommt keinen Unterhalt für den Schulbesuch zum Realschulabschluss, weil dieser nicht angemessen zielstrebig verfolgt wurde, und der Abschluss nicht im realistischen Ausmaß ihrer Fähigkeiten lag (Az. 5 F 100/22).
Beispiel 2. Ein Sohn mit starkem ADHS und einer Lernbehinderung bekommt trotz mangelnder Zielstrebigkeit und dem Abbruch mehrerer Ausbildungen Unterhalt von seinem Vater (Az. 13 UF 12/15). In diesem Ausnahmefall wird ihm das fehlende Engagement nicht zum Vorwurf gemacht, weil es auf seine Erkrankung zurückzuführen ist. Aufgrund dieser fehlte ihm außerdem die Einsicht, dass er psychologische Hilfe benötigte. Die mangelnde Ausbildungsobliegenheit ist deshalb in diesem Fall kein Grund für ein Erlöschen des Unterhaltsanspruchs.
Was, wenn Eltern nicht zahlen wollen?
Wenn Eltern sich weigern, ihrem Kind Ausbildungsunterhalt zu zahlen, obwohl es ein Recht darauf hat, stehen verschiedene Vorgehensweisen offen. Zuallererst sollte man entscheiden, ob man sich überhaupt vorstellen kann, rechtlich gegen die eigenen Eltern vorzugehen. Wenn das Verhältnis zu den Eltern bereits schwierig ist, kann ein Unterhaltsverfahren weiter Öl ins Feuer gießen. Betroffene sollten sich diesen Schritt also gut überlegen. Eine weitere Problematik findet sich darin, dass ab dem 18. Geburtstag das Jugendamt nicht mehr zuständig ist. Es darf, genau wie Elternteile, maximal noch eine beratende Rolle spielen. Unterhaltsberechtigte Volljährige müssen sich vor Gericht also selbst vertreten.
Rechtliche Schritte
Trotzdem können Kinder dagegen vorgehen, wenn Elternteile keinen Unterhalt zahlen wollen oder sich weigern, Angaben zu ihrem Einkommen zu machen. Ohne Informationen zum Einkommen der Eltern ist es nämlich nicht möglich Bafög zu beantragen, auch wenn Sohn oder Tochter eigentlich Anspruch darauf hätten. Elternteile müssen diese Auskunft deshalb geben.
Eine erste Reaktion kann darin bestehen, sich den Rat einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts einzuholen. Das ist natürlich mit Kosten verbunden. Man kann den Unterhaltsanspruch und dessen Höhe auch in einem Unterhaltstitel urkundlich festhalten lassen. Das ist aber, wenn Elternteile und Kind es nicht einvernehmlich beantragen, nur vor Gericht mit anwaltlicher Hilfe möglich. Man muss sich also sowieso an eine Anwältin oder einen Anwalt wenden und kommt um diese Kosten nicht herum.
Vorausleistung beantragen
Wenn die Eltern nicht zahlen wollen oder die Auskunft über ihr Einkommen verweigern, sollte man beim Bafög-Amt einen Antrag auf Vorausleistung stellen. Das bedeutet, dass man das Geld, was eigentlich von den Eltern kommen sollte, stattdessen vom Bafög-Amt ausgezahlt bekommt.
Der Unterhaltsanspruch wird dadurch an das Amt abgetreten, welches wiederum versucht, sich die vorgeleisteten Zahlungen von den unterhaltspflichtigen Elternteilen zurückzuholen. Dabei kann es zu einer Zwangsvollstreckung kommen, wenn sie weiterhin nicht zahlen. Falls herauskommt, dass Eltern nicht zahlungsfähig sind, weil ihr Einkommen so niedrig ist, dass es unter den Grenzwert fällt, wird die Vorauszahlung des Amts zu einem regulären Bafög-Darlehen.
Kindergeld wird auf Vorauszahlungen dabei grundsätzlich angerechnet, weil es als Teil des Unterhalts des Kindes gezählt wird.
Finanzierungshilfen
Für Familien, die eine Ausbildung oder ein Studium des Kindes nicht aus eigenen Stücken finanzieren können, gibt es diverse Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Zum Teil müssen die Förderungen zurückgezahlt werden, teilweise aber auch nicht.
Bafög. Wenn die Eltern ein geringes Einkommen haben, kann zur Finanzierung des Studiums ein Bafög-Antrag gestellt werden. Diese finanzielle Förderung besteht zur Hälfte aus einem Zuschuss, und zur anderen Hälfte aus einem zinslosen Darlehen, welches nach Ende des Studiums zurückgezahlt werden muss. Studierende dürfen zusätzlich auf Minijobbasis Geld dazuverdienen, ohne dass es Abzüge gibt. Ein Anspruch besteht allerdings nicht, wenn Einkommen oder Vermögen der Eltern über dem Grenzwert liegen.
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Eine Finanzierungshilfe für Auszubildende, die aufgrund einer zu hohen Entfernung zum Ausbildungsbetrieb nicht bei den Eltern wohnen können. Es besteht ebenfalls ein Anspruch für Auszubildende, die verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft sind oder waren, oder mindestens ein Kind haben, auch wenn sich der Betrieb in einer erreichbaren Distanz zu ihrem Elternhaus befindet. Dieser Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Die genaue Höhe der BAB richtet sich nach der Unterbringung, Einkommen der Eltern oder des Ehe- oder Lebenspartners, sowie bestehenden Kosten wie zum Beispiel für die Fahrt zum Ausbildungsbetrieb. Das Einkommen des Auszubildenden wird dabei voll angerechnet.
Wohngeld. Das ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für Personen mit geringem Einkommen. Voraussetzung ist, dass sie keine Sozialleistungen erhalten, in welchen die Kosten der Unterkunft bereits berücksichtigt werden. Die Höhe des Wohngelds wird aus diversen Faktoren wie der Höhe der Miete, dem Einkommen und dem Wohnort berechnet. Es muss nicht zurückgezahlt werden. Studierende und Auszubildende bekommen grundsätzlich kein Wohngeld. Nur in Ausnahmefällen haben sie Anspruch: Wenn sie kein Bafög oder BAB erhalten und ihr Einkommen – beziehungsweise das Einkommen der Eltern – dennoch so niedrig ist, dass sie für Wohngeld infrage kommen. Das kann zum Beispiel bei einer Zweitausbildung der Fall sein, oder wenn die Förderungshöchstdauer für Bafög überschritten wurde.
Bildungskredit. Ein Bildungskredit richtet sich an Auszubildende und Studierende in fortgeschrittenen Ausbildungsphasen. Er kann online beim Bundesverwaltungsamt (BVA) beantragt werden. Es handelt sich um einen Kredit der, im Gegensatz zum Bafög, vollständig und mit relativ hohen Zinsen zurückgezahlt werden muss. Diese Variante ist also deutlich teurer. Aufgrund der klar besseren Bedingungen sollte ein Bafög-Antrag immer die erste Wahl sein. Ein Bildungskredit wird allerdings unabhängig vom Einkommen vergeben und bietet eine Alternative, wenn kein Bafög-Anspruch besteht. Er kann auch zusätzlich zum Bafög aufgenommen werden, falls das nicht ausreicht.
Studienkredit. Ein Studienkredit ist ein regulärer Bankkredit zur Studienfinanzierung. Er sollte eine letzte Option bleiben, da ein solcher Kredit im Gegensatz zum Bafög komplett und mit hohen Zinssätzen zurückgezahlt werden muss, was schnell teuer wird. Ein Studienkredit kann aber unter Umständen die beste Lösung sein, wenn sonst zum Beispiel ein Studienabbruch droht.
Stipendien. Ein Stipendium kann eine zusätzliche finanzielle Förderung während des Studiums darstellen. Es gibt nicht nur Angebote für Studierende mit sehr guten Leistungen, sondern auch zum Beispiel für ehrenamtliches Engagement, für Studierende aus nicht-privilegierten Verhältnissen, für Auslandsaufenthalte oder bestimmte Fachgebiete. Für Auszubildende gibt es zum Teil ebenfalls Stipendienprojekte.
Studienstarthilfe. Studienanfänger und -anfängerinnen aus einkommensschwachen Haushalten können einen einmaligen Zuschuss in Höhe 1 000 Euro erhalten. Es gibt sie seit dem Wintersemester 2024/2025. Anspruch besteht nur für Studierende unter 25 Jahren, die bereits Bafög oder andere Sozialleistungen beziehen. Die Studienstarthilfe muss separat beim Bafög-Amt beantragt werden. Den Zuschuss gibt es ausschließlich für neu begonnene Bachelorstudiengänge, nicht für Master.
-

Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende Hilfe bis zum 18. Geburtstag
- Taucht ein Elternteil ab, ist unbekannt oder zahlungsunfähig, streckt der Staat Kindesunterhalt vor – seit 2017 bis zum 18. Geburtstag. Auch Halbwaisen kann das helfen.
-
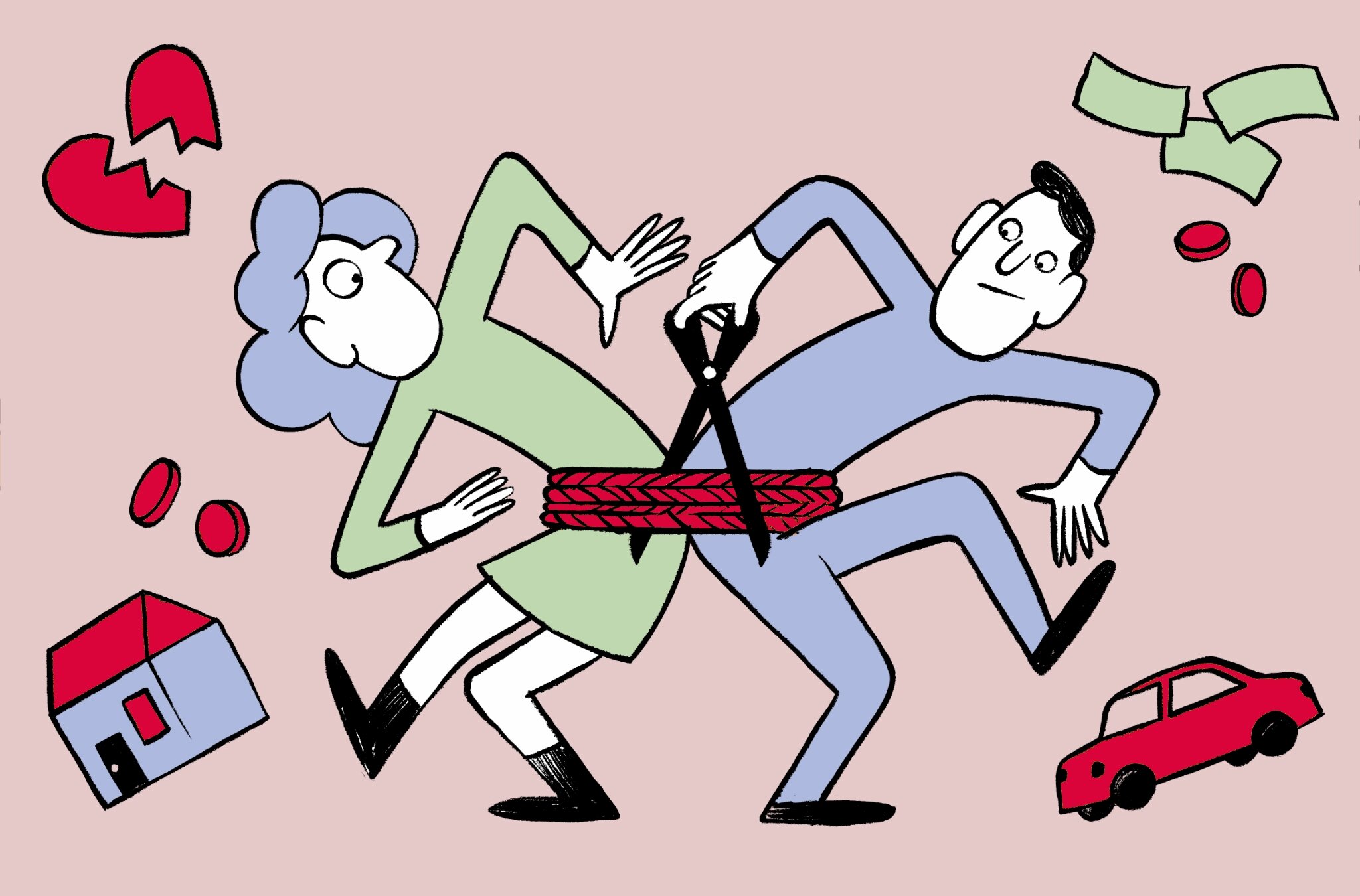
Scheidung Das gilt für Kosten, Kinder, Ehewohnung, Steuer
- Trennung und Scheidung haben rechtliche und steuerliche Folgen. Manchmal ist es wichtig, schnell zu handeln. test.de verrät, worauf Sie achten sollten.
-

Kindergeld ab 18 Wie Sie Kindergeld für Volljährige bekommen
- Für volljährige Kinder in Studium, Ausbildung oder Praktikum steht Eltern Kindergeld zu. Wir sagen, wann die Familienkasse zahlt und wo es noch Geld gibt.
1 Kommentar Diskutieren Sie mit
Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.

Kommentarliste
Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.
Kommentar vom Administrator gelöscht. Grund: Unangemessener Umgangston
"Unterhaltsberechtigte Volljährige müssen sich vor Gericht also selbst vertreten."
Hier beginnt bereits ein möglicherweise folgenschwerer Irrtum. Der Satz muss richtigerweise lauten: "UnterhaltsBEGEHRENDE, unterhaltsBEANSPRUCHENDE Volljährige müssen sich vor Gericht also selbst vertreten."
Begehrende & beanspruchende Personen verkennen oft, dass Eltern allen ihren Kindern und allen ihren möglichen Enkelkindern, eine gerechte also ungefähr gleichwertige Unterstützung zukommen lassen wollen. Wer solch einfache Lebensweisheiten nicht anerkennt, sondern alleine aus Begehren & Anspruch eine Berechtigung ableitet, muss eben später, wenn es um Enkelkinder geht, sowie im Erbfall, für die "Jugendsünden" bezahlen - im Sinne von selber bezahlen, selber leisten, selber verantworten. Ist auch eine Form des Darwinismus.